Kooperatives Lernen digital: Sind wir bereit? Wissenschaftliche Ergebnisse aus Co³Learn
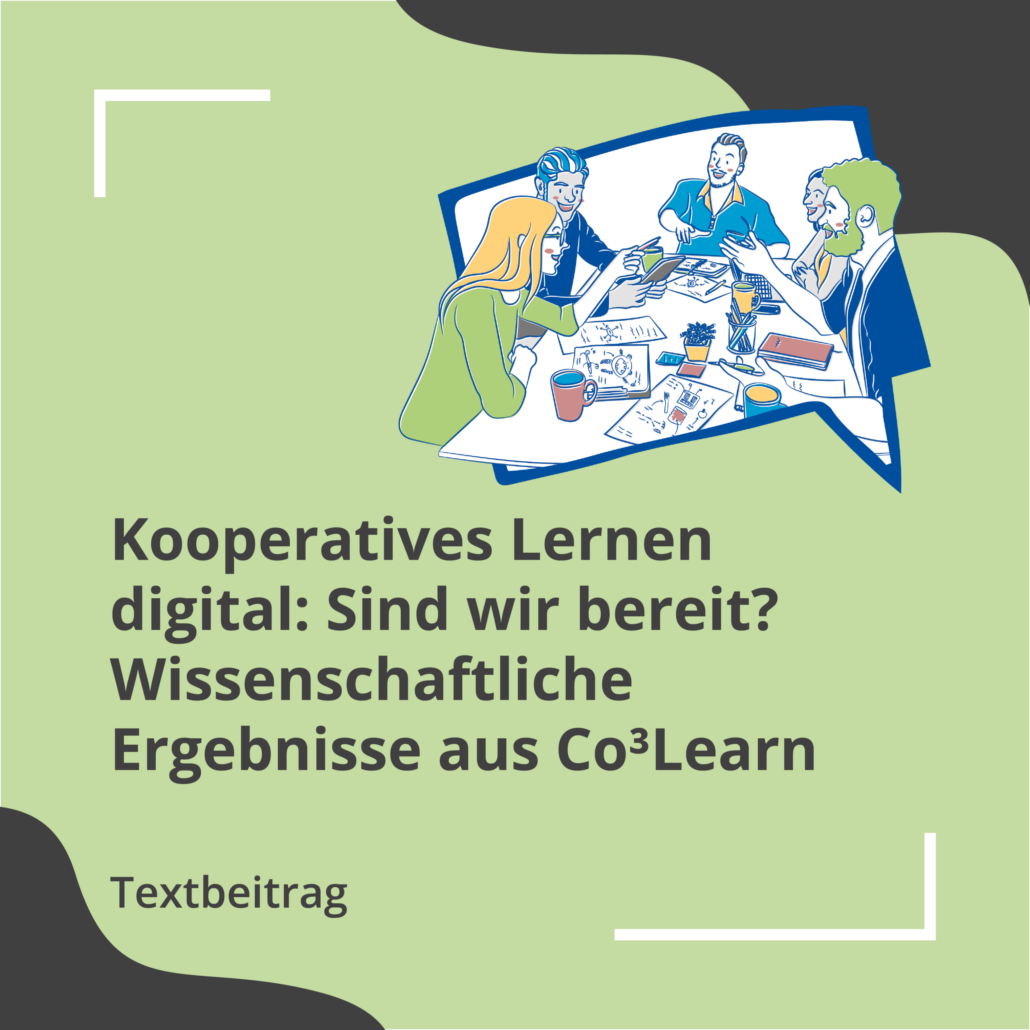
Kooperatives Lernen digital: Sind wir bereit? Interview mit Prof. Dr. Lysann Zander und Kim Jördens Wissenschaftliche Ergebnisse aus Co³Learn Wie gut sind Hochschulakteur*innen auf digitales kooperatives Lernen vorbereitet? Das Projekt Co³Learn liefert spannende wissenschaftliche Erkenntnisse zu Chancen und Herausforderungen kooperativen Lernens im digitalen Raum – für Studierende und Lehrende gleichermaßen. In diesem Beitrag stellen Kim Jördens und Prof. Dr. Lysann Zander zentrale Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitstudie vor. Eine umfassende Befragung untersuchte, wie digitale Tools eingesetzt und genutzt werden – und welche Rolle dabei Einstellungen und Rahmenbedingungen spielen. Die Auswertung zeigt: Viele Tools werden bislang nur begrenzt genutzt. Im Mittelpunkt stehen daher nicht nur technische Aspekte, sondern auch die kooperativen Mindsets von Studierenden und Lehrenden sowie das Veranstaltungsklima als Schlüsselfaktor für gelingende Zusammenarbeit. Das Team der wissenschaftlichen Begleitung führte in regelmäßigen Abständen in verschiedenen Lehrveranstaltungen an den drei Verbunduniversitäten TU Braunschweig, Georg-August-Universität Göttingen sowie der Leibniz Universität Hannover Befragungen durch. Daran nahmen sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden aus über 50 Lehrveranstaltungen teil. Es wurde zum Beispiel nach Einstellungen zum Studium, dem Einsatz von digitalen Tools und dem Wohlbefinden von Studierenden gefragt. Welche Erkenntnisse liefert die Studie zur Wahrnehmung von Studierenden beim digitalen kooperativen Lernen? Unter welchen Bedingungen gelingt digitale Zusammenarbeit? Wir befinden uns noch mitten in der Auswertung der umfangreichen Datensätze; die Ergebnisse werden schrittweise wissenschaftlich publiziert. Aus den bisherigen Analysen lassen sich aber bereits drei Einsichten ableiten, die über die Frage „funktioniert digital oder nicht?“ hinausgehen. Erstens zeigt sich im Querschnitt ein klares Muster: Studierende mit kooperativen Mindsets erleben das Kursklima häufiger als unterstützend, und dieses wahrgenommene Kursklima hängt wiederum damit zusammen, ob digitale Kooperationsprozesse als lernförderlich bewertet werden (Jördens/Nöth/Zander 2024). Entscheidend ist damit weniger das Tool an sich als seine soziale und didaktische Einbettung – also ob die Lernumgebung Orientierung, Fairness, Wertschätzung und psychologische Sicherheit vermittelt. Zweitens verschiebt die Längsschnittanalyse den Blick: Ein positives Kursklima trägt langfristig dazu bei, dass kooperative Mindsets stärker werden, nicht aber umgekehrt (Jördens/Nöth/Zander 2025). Mindsets erscheinen damit nicht als fixe Eigenschaft, sondern als durch Erfahrungen formbar; Kursgestaltung wird zur zentralen Stellschraube, weil sie kooperative Haltungen überhaupt erst verlässlich hervorbringt und stabilisiert. Drittens ergänzt ein weiteres Paper diese Perspektive um ein konkretes Verhaltensbindeglied: In einer Studie fanden wir, dass Studierenden mit kooperativen Mindsets eher konstruktiv und selbstbestimmt Hilfe suchen (autonomieorientiertes Help-Seeking) und Hilfe seltener vermeiden – und dieses Hilfeverhalten steht wiederum mit höherem akademischem Engagement in Verbindung, besonders deutlich bei männlichen Studierenden (Zander/Halabi/Höhne i.E.). Besonders überraschte uns der Befund, dass entgegen verbreiteter Erwartungen MINT-Studierende im Mittel sogar stärkere kooperative Mindsets als Nicht-MINT-Studierende zeigten. Das deutet darauf hin, dass gerade in MINT ein relevantes Kooperationspotenzial vorhanden sein kann, das jedoch nicht automatisch sichtbar und vor allem nicht automatisch genutzt wird. Da kommen die Dozierenden in’s Spiel! Kapitel Literatur Interviewpartnerinnen Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen Kooperatives Lernen digital: Sind wir bereit? Wissenschaftliche Ergebnisse aus Co³Learn 12# Wissensnugget – Winterpause Instagram als projektbegleitende Kommunikationsplattform für studentische Beteiligung Kategorien Aktuelle Veranstaltungen Allgemein Evaluation How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Was können Lehrende tun, um Toolnutzung und gelingende Zusammenarbeit zu begünstigen? Unser Eindruck ist: Kooperation ist in vielen Lehrveranstaltungen bereits fest verankert, und Studierende erkennen grundsätzlich ihren Wert. Gleichzeitig ist die Bewertung von Gruppenarbeit häufig ambivalent, weil viele Studierende negative Erfahrungen machen – etwa durch ungleiche Arbeitsverteilung, Unzuverlässigkeit, unklare Erwartungen oder als unfair empfundene Bewertungspraktiken (zum Beispiel gleiche Note für alle trotz unterschiedlicher Beiträge). Klar ist: Kooperation ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Kompetenz, die gezielt aufgebaut werden muss. Lehrende können das unterstützen, indem sie Kooperationsphasen (Lernen und Üben) und Performanzphasen (Bewertung und Prüfung) bewusst trennen, Transparenz in Zielen, Rollen, Abläufen und Bewertungskriterien herstellen (einschließlich nachvollziehbarer Kriterien für individuelle Beiträge) und Aufgabenformate wählen, in denen Kooperation einen echten Mehrwert erzeugt, etwa durch arbeitsteilige Perspektiven, wechselseitige Abhängigkeiten und gemeinsame Syntheseprodukte statt bloßer Aufteilung in Einzelteile. Digitale Tools sollten dabei nicht „on top“ eingesetzt werden, sondern funktional an den Kooperationsprozess gekoppelt sein, beispielsweise für gemeinsames Planen, Dokumentieren, Feedback oder Versionierung. Dies war jedoch nicht Thema unserer wissenschaftlichen Begleitstudie. Welche Aspekte sind bei der Zusammensetzung der Kleingruppen mit Blick auf Diversität zu beachten? Für heterogene Gruppen ist aus der Forschung und aus Praxiserfahrungen besonders wichtig, Zeit und Struktur für den Aufbau einer gemeinsamen Grundlage einzuplanen, also für eine gemeinsame Wissensbasis, geteilte Erwartungen sowie Kommunikations- und Arbeitsregeln. Gerade rein digitale Startphasen können das erschweren. Günstig kann ein Wechsel von Präsenz- und Digitalphasen sein, insbesondere um Vertrauen aufzubauen, Missverständnisse zu reduzieren und gemeinsame Routinen zu etablieren. Diese Punkte stammen allerdings eher aus Erfahrung, der breiteren Forschung und Praxisliteratur, hier bedarf es noch systematischer Forschung; sie waren nicht Kern der wissenschaftlichen Begleitforschung im Projekt. Wie können Lehrende die Akzeptanz von Toolnutzung für digitale Kollaboration unterstützen? Akzeptanz steigt typischerweise, wenn Lehrende Anreize für den Einsatz schaffen und Modelllernen ermöglichen: also Tools sichtbar und selbstverständlich nutzen, den Mehrwert konkret demonstrieren und eine offene, zuversichtliche Haltung vorleben, statt Unsicherheit oder Abwehr zu signalisieren. Eine Kultur von Neugier und Erprobung zusammen mit einer offenen und konstruktiven Gesprächsatmosphäre über Herausforderung bei der Nutzung kann sehr hilfreich sein. Auch dieser Bereich wurde im Projekt nicht systematisch untersucht, ist aber eine relevante Anschlussfrage für ein Folgeprojekt. Wie können Serviceeinrichtungen (Rechenzentrum, Beratung Hochschuldidaktik) Lehrende und Studierende beim Einsatz von Tools für gelingende Kooperation unterstützen? Serviceeinrichtungen spielen eine Schlüsselrolle, damit digitale Kooperations-Tools wirksam und nachhaltig genutzt werden. Aus unserer Erfahrung sind vor allem drei Aspekte entscheidend: Erstens eine praxisnahe und kontinuierliche Begleitung der Lehrenden, denn erst wenn sie Sicherheit im Tool-Einsatz gewinnen, wird dieser zuverlässig in der Lehre umgesetzt. Zweitens eine ressourcenschonende Unterstützung, weil Lehrende nur begrenzte Zeit haben; hier helfen kurze, zielgerichtete Schulungsformate, Best-Practice-Beispiele, Vorlagen sowie niedrigschwelliger Support, etwa Sprechstunden oder kompakte How-to-Materialien. Drittens die Befähigung der Lehrenden, Studierende strukturiert in die Toolnutzung einzuführen. Das ist zwar zusätzlicher Aufwand, zahlt sich aber aus: Gut vorbereitete Lehrende und informierte Studierende schaffen gemeinsam die Grundlage für gelingende digitale Kooperation. Literatur Jördens, K. A., Nöth, L., & Zander, L. (2025, September). Wie das Kursklima ein kooperatives Mindset bei Studierenden fördert: Eine längsschnittliche Analyse universitärer Lehrveranstaltungen. Vortrag
Evaluation Wissensnugget – Gesamtauswertung

Evaluations Wissensnugget –Gesamtauswertung Mit der Veranstaltungsreihe „Wissensnuggets“ bot das Team des Verbundprojekts Co³Learn ein knackiges Format mit anwendungsbezogenen Einblicken in Themen rund um digitale Kommunikation, Kooperation und Kollaboration an der Hochschule. In den 45-minütigen „Nuggets“ erhielten Teilnehmende ganz konkrete Impulse für Ihre Lehre jeweils anhand von zwei Anwendungsszenarien aus der Praxis. Die Nuggets wurden von Expert:innen aus dem Co³Learn-Team von der TU Braunschweig, Leibniz Universität Hannover und Georg-August-Universität Göttingen sowie externen Sprecher:innen gestaltet. In den 12 Veranstaltungen seit Januar 2025 nahmen insgesamt über 350 Lehrende, Didaktiker*innen, Personen aus dem IT-Support und Projektmitarbeitende aus ganz Deutschland teil. Die kurze Evaluation lief über vier Wochen zwischen Oktober und November 2025. Kompakte Zusammenfassung zentraler Ergebnisse An der Umfrage nahmen je nach Frage circa 40 Personen teil. Das Wissensnugget-Format wird insgesamt als sehr positiv bewertet: Die meisten werden durch Kolleg:innen oder Hochschulkommunikation (Newsletter, Veranstaltungshinweise, u.ä.) darauf aufmerksam. Mehr als zwei Drittel haben 1–3 Nuggets besucht, die Themen werden überwiegend als relevant eingeschätzt. 62 % konnten Neues lernen, besonders zu KI-Tools und didaktischen Methoden. Die Atmosphäre, Moderation und kompakte Struktur sind zentrale Erfolgsfaktoren. Der Austausch wird teils angeregt, führt aber selten zu neuen Kontakten. Die meisten wünschen sich Optionen für mehr Interaktivität, aber ohne Zwang. Ein Präsenzformat wird von der Mehrheit nicht benötigt. Zukünftige Themen sollen besonders KI, Didaktik, Motivation und praktische Tools umfassen. Nur wenige möchten selbst ein Nugget anleiten – das Format wird eher als Inspirationsraum statt als aktive Bühne wahrgenommen. Insgesamt zeigt die Evaluation, dass das Format Wissensnugget beliebt ist und als niedrigschwellig, gut moderiert sowie inhaltlich wertvoll wahrgenommen wird. Optimierungspotenzial des Formates liegt vor allem in Interaktivität, Beispieltiefe und Sichtbarkeit. Auszug aus der Einzelauswertung Wie viele Wissensnuggets hast du besucht? (N = 42 Befragte) Anzahl Anteil Stimmen keins 19 % 8 1–3 67 % 28 4–6 10 % 4 mehr als 7 5 % 2 Konnte etwas Neues gelernt werden? (N = 42 Befragte) Antwort Anteil Stimmen Ja 62 % 26 Teilweise 26 % 11 Nein 12 % 5 Wie bist du auf das Format Wissensnugget aufmerksam geworden? (N = 43 Befragte) Kanal Anteil Stimmen Empfehlung von Kolleg:innen 37 % 16 Veranstaltungshinweise der Hochschule 26 % 11 E-Mail / Newsletter 19 % 8 Social Media (Academic CloudHub / LinkedIn) 19 % 8 Co3Learn-Website 7 % 3 Sonstiges 9 % 4 Warum hast du das Wissensnugget besucht? (N = 42 Befragte – Mehrfachnennungen) Grund Anteil Stimmen Zur eigenen Weiterbildung 62 % 26 Neue Impulse für die eigene Lehre 45 % 19 Neugier / Interesse 45 % 19 Andere Lehrende kennenlernen / Austausch über Umsetzung 17 % 7 Dauer des Wissensnuggets (36 Befragte) Dauerempfinden Anteil Stimmen Genau richtig 92 % 33 Zu kurz 6 % 2 Zu lang 3 % 1 Was ist besonders im Gedächtnis geblieben? (N = 36 Befragte) Häufige Themen: KI-Tools: NotebookLM, ChatAI, Arcana, RAG-Manager, Napkin AI Methodik & Didaktik: Storytelling, dreiteiliger Aufbau, Whiteboard-Einsatz Atmosphäre & Moderation: wertschätzend, locker, guter Austausch Organisation & Design: tolles Format, schönes Design, gute Vorbereitung Beispiele & Anwendung: Gather, SAP Scenes, CC-lizenzierte Materialien Kritikpunkte: fehlende Beispiele zu komplexen Lehrproblemen, NotebookLM unpassend Anregung zum Austausch mit Lehrenden? (N = 37 Befragte) Antwort Anteil Stimmen Ja 38 % 14 Teilweise 35 % 13 Nein 16 % 6 Weiß ich nicht mehr 11 % 4 Präsenzformat einmal jährlich? (N = 36 Befragte) Antwort Anteil Stimmen Nein, Online reicht 72 % 26 Ja unbedingt 14 % 5 Kommt darauf an 14 % 5 Übersicht aller Wissensnuggets
12# Wissensnugget – Winterpause

12# Wissensnugget im Dezember – Winterpause im Januar geht’s weiter mit frischen Nuggets für deine Lehre im Verbundprojekt Digitale Lehre Hub Niedersachsen! Was steckt dahinter?Im Dezember verabschiedet sich unser Wissensnugget in die Winterpause – und gleichzeitig endet das Projekt, in dem es entstanden ist. Nach vielen spannenden Themen, inspirierenden Gesprächen und wertvollen Momenten des Austauschs ist jetzt ein guter Moment, innezuhalten. Wir blicken dankbar zurück auf eine gemeinsame Reise voller Ideen, Neugier und Lernfreude. Zum Abschluss möchten wir Danke sagen – an alle, die dabei waren, mitgedacht, ausprobiert und die Idee des gemeinsamen Lehrens und Lernens lebendig gemacht haben. Und keine Sorge: Das Wissensnugget geht weiter!Es wird zukünftig vom Verbundprojekt Digitale Lehre Hub Niedersachsen weitergeführt und gestaltet – damit auch in Zukunft die Vernetzung unter Lehrenden in Niedersachsen gestärkt wird. Dein FeedbackWer zum Abschluss ein kurzes Feedback geben möchte, kann dies gern hier in unserer Evaluation des Wissensnuggets tun. Wie geht’s weiter? Nächste Termine: findest du im Kalender des Academic Cloud Hubs (mit Anmeldung). Bisherige Inhalte: bleiben weiterhin verfügbar.Bitte beachte: Die Webseite wird bis Dezember 2025 gepflegt. Bis dahin sind alle Inhalte geprüft, korrekt und aktuell. Für Änderungen oder Aktualisierungen nach diesem Zeitpunkt können wir keine Gewähr übernehmen. Viele unserer Inhalte findest du außerdem weiterhin aufbereitet im Dossier „Digitale Kooperation“ beim Hochschulforum Digitalisierung – ein Besuch lohnt sich!
11# Wissensnugget – Chat AI als Lernbuddy

11# Wissensnugget im November ChatAI als Lernbuddy – KI zur Unterstützung von Studierenden Austauschformat am 27. November 2025 Anmeldung Wie lässt sich Künstliche Intelligenz sinnvoll in der Lehre einsetzen, um Studierende aktiv zu unterstützen? Beim Wissensnugget am 27. November 2025 von 14:30 bis 15:15 Uhr dreht sich alles um den Einsatz von ChatAI als Lernbuddy – also als digitalen Tutor, der Lernprozesse begleitet und Lehre interaktiver macht. Der Referent gibt zunächst einen kompakten Überblick darüber, was ChatAI ist, was es besonders macht und wie Lehrende es in ihre Lehre einbinden können. Anschließend zeigt er konkret, wie sich Vorlesungsskripte, Lernmaterialien oder Inhalte in ChatAI integrieren lassen, um Studierenden ein eigenständiges Üben und Wiederholen zu ermöglichen. Im Anschluss an den Input gibt es Raum zum Ausprobieren und für den kollegialen Austausch: Welche Potenziale bietet KI für Lehre und Lernen? Welche Chancen und Grenzen sehen Lehrende im Einsatz solcher Tools? In 45 Minuten erhalten Teilnehmende Impulse zu: ChatAI als digitalem Lernbegleiter in der Hochschullehre Möglichkeiten, Vorlesungsskripte interaktiv erlebbar zu machen Förderung von selbstständigem Lernen durch KI-gestützte Tools Praxisbeispiele und didaktische Tipps für den Einsatz von ChatAI Austausch und Vernetzung mit Kolleg:innen Termin: 27. November 2025, 14:30 UhrFormat: Online – 45 Minuten (BigBlueButton)Referent: Marvin Westerveld, Ostfalia Das Wissensnugget richtet sich an Lehrende aller Fachrichtungen, die KI in der Lehre praktisch erproben und erfahren möchten, wie sich ChatAI sinnvoll in den Lernprozess integrieren lässt. Die Anmeldung erfolgt formlos über den Academic Cloud Hub im Space „Digitale Kollaboration und Kooperation“ oder direkt über diese Website. Die Veranstaltung wird organisiert von Co³Learn, einem Verbundprojekt der Universitäten Braunschweig, Göttingen und Hannover, das innovative Ansätze zur digitalen Lehre fördert.
10# Wissensnugget – In Geschichten denken – Storytelling als Lehrstrategie

10# Wissensnugget im Oktober In Geschichten denken – Storytelling mit Scenes als LehrstrategieAustauschformat am 28. Oktober 2025 Anmeldung Wie lassen sich Lehrinhalte so gestalten, dass sie nicht nur verstanden, sondern auch erinnert, diskutiert und gemeinsam weitergedacht werden? Storytelling ist eine wirksame Lehrstrategie, um genau das zu erreichen. Beim nächsten Wissensnugget am 28. Oktober 2025 von 14:30 bis 15:15 Uhr geht es darum, wie Geschichten – unterstützt durch das Tool Scenes – Lehrveranstaltungen lebendig machen und Studierende aktivieren. Referentin Sarah Zerwas gibt anschauliche Einblicke in ihre eigene Lehrpraxis und zeigt anhand vielfältiger Beispiele, wie Storytelling eingesetzt werden kann: zur Einführung neuer Themen, zur Strukturierung komplexer Inhalte, zur Förderung von Kooperation und Kollaboration und vor allem, um Studierende aktiv einzubinden. Dabei stellt sie konkrete Methoden und digitale Formate vor, die sich mit wenig Aufwand in den Lehralltag integrieren lassen. In 45 Minuten erhalten Teilnehmende Impulse zu: Storytelling als didaktisches Prinzip Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Lehrformaten Aktivierung von Studierenden durch narrative Methoden Das Tool Scenes für Kooperation und Kollaboration in der Lehre Austausch: Wie kann Storytelling im eigenen Fachbereich aussehen? Termin: 28. Oktober 2025, 14:30 UhrFormat: Online – 45 Minuten (BigBlueButton)Referentin: Sarah Zerwas (Universität Braunschweig) Das Format richtet sich an Lehrende aller Fachrichtungen, die ihre Inhalte wirkungsvoller und motivierender vermitteln möchten. Im offenen Erfahrungsaustausch werden Ideen gesammelt, diskutiert und weiterentwickelt. Die Anmeldung erfolgt formlos über den Academic Cloud Hub im Space „Digitale Kollaboration und Kooperation“ oder direkt über diese Website. Die Veranstaltung wird organisiert von Co³Learn, einem Verbundprojekt der Universitäten Braunschweig, Göttingen und Hannover, das innovative Ansätze zur digitalen Lehre fördert.
Unser Weg zur Zusammenarbeit im Projektkontext
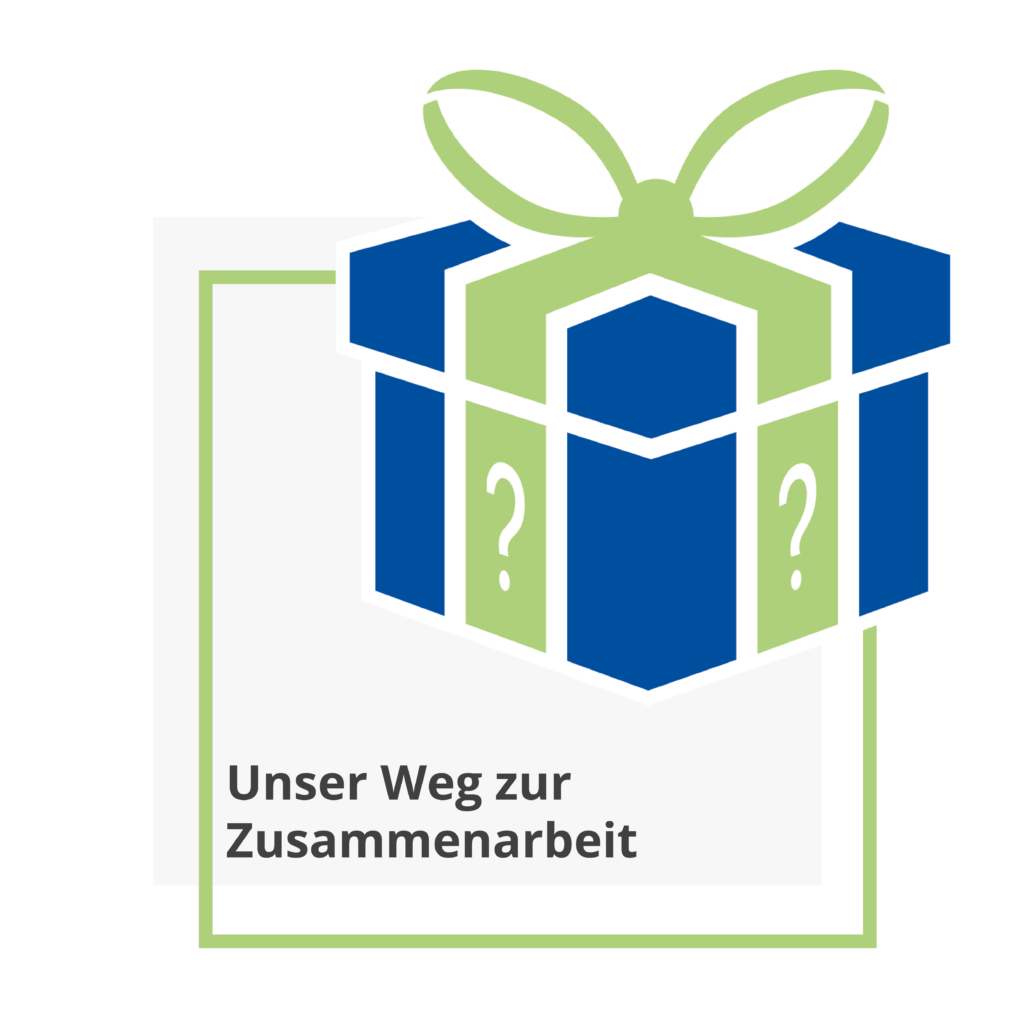
Unser Weg zur Zusammenarbeit Online-Office Ausschnitt von Co³Learn, Screenshot mit Genehmigung von Gathertown erstellt. CC-BY-NC-ND (4.0) Scrum in Hochschulprojekten. Fotos Klausurtagung Co³Learn. Fotografin Julika Moos Aus dem virtuellen Raum ins echte Miteinander Scrum in Hochschulprojekten – Zwischen Regelwerk & Realität Teamkultur als Erfolgsfaktor Die Zusammenarbeit im Projekt ist bewusst digital und agil ausgerichtet. Wir nutzen diese Prinzipien so, dass sie unsere Prozesse unterstützen. Deshalb sehen wir uns seit Beginn jeden Morgen virtuell und alle paar Wochen für eine intensive Zusammenarbeit auch vor Ort an einem der Verbundstandorte. Wir sind mit rein digitaler Zusammenarbeit gestartet und haben uns erst nach über einem halben Jahr das erste Mal in Präsenz getroffen. Unser virtuelles Büro hat sich mit der Zeit weiterentwickelt. Jede*r kann ihren oder seinen Arbeitsplatz hier individuell gestalten und andere Teammitglieder direkt an deren Schreibtisch besuchen, wenn es etwas zu besprechen gibt. Wir haben unterschiedliches ausprobiert, auch mal umgestaltet und arbeiten nun in Gathertown zusammen. Scrum hat eigentlich feste Vorgaben und Abläufe. Über die Zeit haben wir die für uns effektivsten mitgenommen und das weggelassen, was nicht passt. Geblieben sind Dailys (tägliche kurze Treffen), Retros (Retrospektive: Reflexion der Zusammenarbeit) und uns in regelmäßigen Abständen mit den Product Ownern (vertreten die Interessen der Stakeholder) zu treffen. Jedoch sind die Abstände der Treffen größer geworden und die Strukturen in Retros und Dailys offener, so dass wir sowohl Zeit für Zwischenmenschliches und langfristige Planung als auch aktuelle Herausforderungen haben. Wir haben auch einen Beitrag im HFD Dossier „Digitale Kollaboration“ zu unserer Arbeitsweise mit Scrum veröffentlicht. Eine gute Arbeitsatmosphäre ist uns wichtig, so können wir auch gute Ergebnisse schaffen. Deshalb haben wir insbesondere ab Anfang des Projektes viel Zeit in unsere Entwicklung, die Anpassung von Strukturen und den Austausch gesteckt. Dies war vor allem durch die Unterstützung der Stiftung Innovation in der Hochschullehre möglich, an die an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön geht. Hierdurch konnten wir intensive Präsenztage der Zusammenarbeit in Wolfenbüttel, Walsrode und Bad Harzburg umsetzen.
Neues wagen & eigene Wege gehen
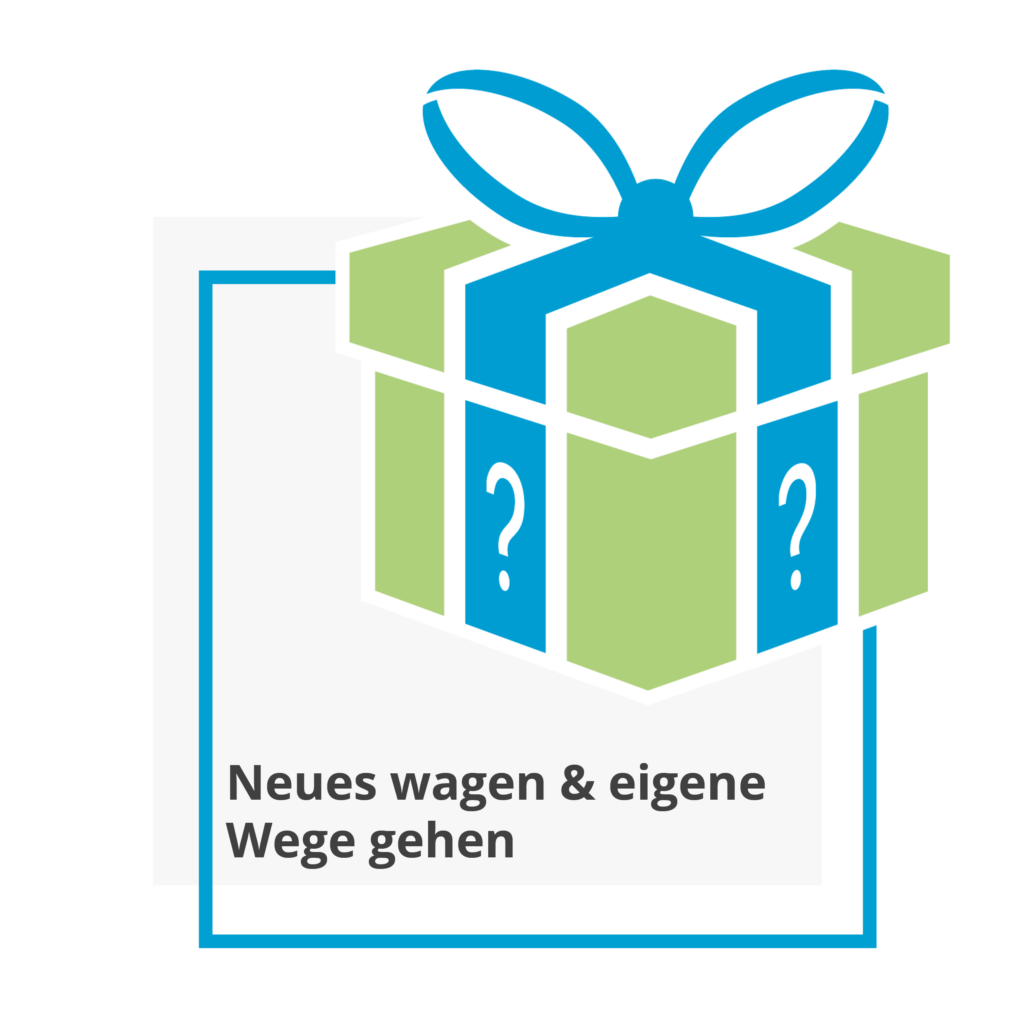
Neues wagen und eigene Wege gehen Niedersachsenweite Großveranstaltung Unser „Festival of Digital Connections“ für Studierende haben wir mit 39 Programmpunkten, verschiedenen Influencer*innen aus dem Bereich „Lernen und Studieren“, Gaming Area, Smoothie Bar, Donut Station, VR-Station, Tool-Messe, Sportprogramm, Hygienekonzept und 2 Kisten (ca. 36 Kilo) Bananen ausgerichtet. Es haben ca. 200 Studierende aus ganz Niedersachsen an dem zweitägigen Festival 2022 teilgenommen. Ausgefallene Werbeaktion Für ein digitales Produkt haben wir analog geworben: Es entstand eine Postkarte zur Academic Cloud, die Universitätsangehörige über das Projekt verschicken konnten. Die Academic Cloud stellt kuratierte und lizenzierte digitale Tools sowie Anwendungen für Forschung, Lehre, Lernen und Arbeit bereit. Diese Services können Lehrende, Studierende und Mitarbeitende an Universitäten, Hochschul- und Forschungseinrichtungen in Niedersachsen sowie darüber hinaus nutzen. Veranstaltung mit verschiedensten Perspektiven Lehrende, Studierende und zwei Coaches aus dem Wirtschaftsbereich setzten sich im Workshop „Warum Gruppen stolpern – und wie sie wieder aufstehen“ gemeinsam mit dem Scheitern von Gruppenarbeiten auseinander. Im Umkehrschluss erarbeiteten sie, welche Stolpersteine präventiv aus dem Weg geräumt werden können. Angebote mit hoher Reichweite Mit verschiedenen Beiträgen aus dem Themenbereich Digitale Kollaboration haben wir das gleichnamige Dossier beim Hochschulforum Digitalisierung gefüllt. Gleichzeitig haben wir im Academic Cloud Hub einen eigenen Space für den Austausch in diesem Themenbereich aufgebaut. Diese Plattform ermöglicht es Lehrenden, sich deutschlandweit zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam an neuen Konzepten zu arbeiten. Weiterentwicklung eines Lernmanagement-System für mehr Zusammenarbeit im Studium Um Kommunikation, Kooperation und Kollaboration unter Studierenden zu fördern, haben wir das Forum in Stud.IP (Lernmanagement-System, LMS) mit einer modernen Oberfläche und neuen Funktionen ausgestattet. Die neue Infrastruktur sowie ein überarbeitetes Nutzungskonzept verbessern die Usability und fördern den Austausch in Lehrveranstaltungen sowie darüber hinaus. Diese Bausteine stärken damit das Lernmanagement-System mit Blick auf die Unterstützung der Zusammenarbeit unter Studierenden.
Hochschulübergreifend von Tools profitieren

Hochschulübergreifend von Tools profitieren Das Projekt Co³Learn verfolgt eine klare Vision. Wir baten OpenAI GPT-4o, diese in Form eines Gedichts zu formulieren, und erhielten ein Sonett über frische, neue Bildung. Im Rahmen unserer Toolauswahl schickten wir auch Personas auf eine Customer Journey. Erkennen Sie sich in einem dieser beiden Lehrenden wieder? Im Rahmen unserer Bedarfserhebung fragten wir u.a. Lehrende, welche digitalen Tools und Anwendungen sie für die Zusammenarbeit mit Studierenden hilfreich finden. Das sagen Lehrende: Bei der Auswahl der Tools arbeiteten wir auch auf Prozess-Ebene: Wie kommt man eigentlich zu der konkreten Entscheidung, ein bestimmtes Tool zu lizenzieren, oder eben nicht? Hier ein Ablauf als Beispiel: Tatsächlich hat das Projekt Co³Learn nicht nur digitale Tools an den beteiligten Universitäten bereitgestellt, sondern hat diese für die eigene standortübergreifende Arbeit auch selbst genutzt. Hier ein paar Perspektiven aus dem Team auf unseren Alltag mit Tools:
Entdecken im Fokus
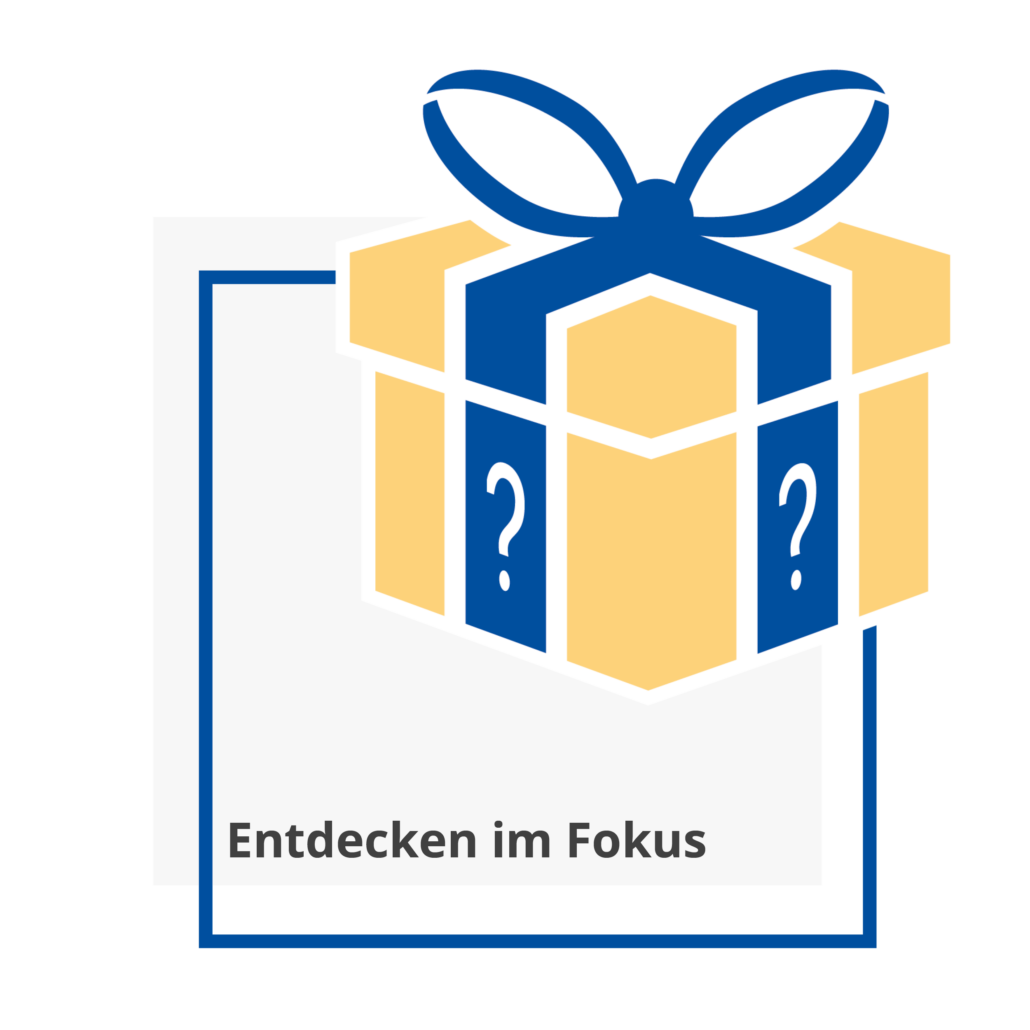
Entdecken im Fokus Entdeckungen Die Academic Cloud Niedersachsen, Stand 04-2025. Selbst erstellte Collage aus Screenshots der Academic Cloud Seite mit Genehmigung der GWDG. CC-BY-NC-ND (4.0). https://www.co3learn.de/wp-content/uploads/2025/09/Animationsfilm_Co3Learn_UE_Version.mp4 Create Your Future. Verbundprojekt Co³Learn, 2025.Emily Brockmann, CC-BY-NC-ND (4.0). Gif-Collage zur Entwicklung der Website des Verbundprojekts. CC-BY-NC-ND (4.0). Verschiedene Plakate für Veranstaltungen des Verbundprojekts als Collage. CC-BY-NC-ND (4.0). Verschiedene Materialien des Verbundprojekts als Collage. CC-BY-NC-ND (4.0). Verschiedene Fotos des Festival of Digital Connections 2022 als Collage. CC-BY-NC-ND (4.0). Verschiedene Illustrationen des Verbundprojekts als Collage. CC-BY-NC-ND (4.0). Die Stud.IP Toolbox der Technischen Universität Braunschweig, Stand 04-2025. Selbst erstellter Screenshot. CC-BY-NC-ND (4.0). Selbst erstelltes Bingospiel zum Kennenlernen und Einsatz in der Lehrveranstaltung des Verbundprojekts. CC-BY-NC-ND (4.0). https://www.co3learn.de/wp-content/uploads/2025/09/10_Video_Instagramkanal.mp4 Überblick über Angebot des Instagram-Kanals des Verbundprojekts Co³Learn, Stand 08-2024. CC-BY-NC-ND (4.0).
Abschlussbericht – Lootboxen
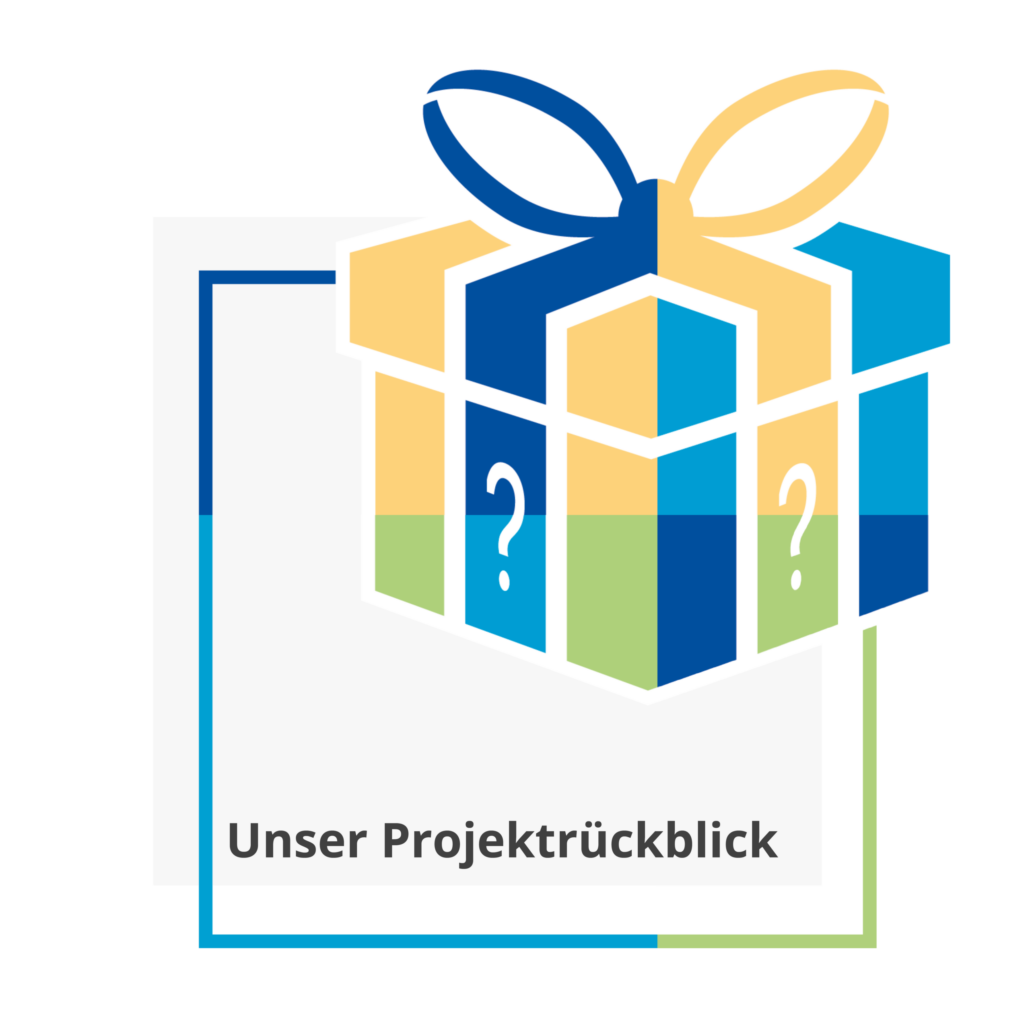
Unser Projektrückblick Unser Projektrückblick Lassen Sie sich überraschen! Statt klassischer Texte präsentieren wir unseren Projektrückblick in Form von Lootboxen. Jede Box gibt Einblicke in Erfahrungen, Highlights und Erkenntnisse, die unseren gemeinsamen Weg durch das Projekt widerspiegeln. Beim Stöbern lassen sich unterschiedliche Facetten entdecken, die die Vielfalt unserer Arbeit zeigen. So entsteht ein lebendiger Einblick, der zum neugierigen Erkunden einlädt.

