Ein Blick in den Seminarraum: Abstrakte Konzepte veranschaulichen mit Flinga
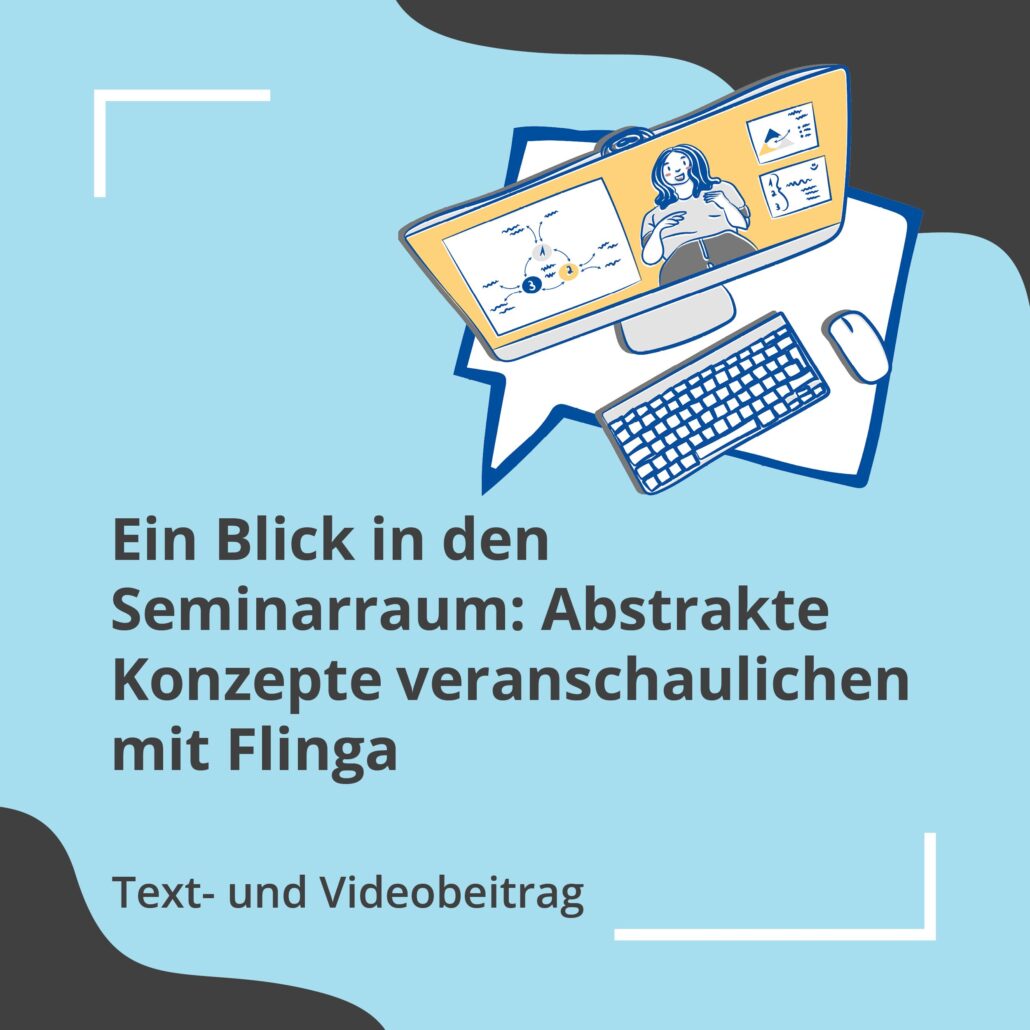
Ein Blick in den Seminarraum: Abstrakte Konzepte veranschaulichen mit Flinga von Katrin Meyer & Verbundprojekt Co³Learn Wie lassen sich Studierende aktivieren und gleichzeitig abstrakte Konzepte vermitteln? Katrin Meyer nutzt ein Whiteboard-Tool, um anhand konkreter Beispiele verschiedene statistische Analyseverfahren mit Leben zu füllen. Mit einem Online-Whiteboard lassen sich von mehreren Personen gleichzeitig Inhalte an einem Ort sammeln, anordnen und bearbeiten. Über einen geteilten Link können alle Teilnehmenden einfach im Browser das Whiteboard besuchen. Ein Teilen per QR-Code ermöglicht die Teilnahme mit mobilen Endgeräten. Auch die Göttinger Lehrende Katrin Meyer setzt digitale Whiteboards in ihrer Lehre ein, so auch in ihrem Kurs „Statistical Data Analysis with R“. Wir erhielten im Rahmen einer Hospitation einen Einblick, wie sie das Online-Tool Flinga während einer Live Exercise nutzte. Hier entstanden ein Bildschirm-Mitschnitt und ein schriftliches Interview zum Thema Whiteboards. Online-Whiteboards ermöglichen das gemeinsame Sammeln und dynamische Anordnen von Wissen auf Karten. Selbst erstellter Screenshot des von Katrin Meyer verwendeten Boards aus Teilnehmendensicht in Flinga mit Genehmigung von Flinga erstellt. CC BY-SA 4.0. Kapitel Das Anwendungsbeispiel im Detail: Eine Live Exercise mit digitaler Unterstützung Autorinprofil Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen 12# Wissensnugget – Winterpause 11# Wissensnugget – Chat AI als Lernbuddy Instagram als projektbegleitende Kommunikationsplattform für studentische Beteiligung Kategorien Aktuelle Veranstaltungen Allgemein How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Katrin Meyer nutzte das Whiteboard-Tool Flinga gemeinsam mit den Studierenden um Fallbeispiele zu sammeln. Im Interview fragten wir Katrin Meyer, welche Vorteile sie in der Nutzung digitaler Whiteboards sieht. Mit Flinga ist es einfach, Ordnung zu halten. Das erleichtert es Katrin Meyer, die Diskussion zu moderieren. Verschiedene Whiteboard-Tools kommen mit unterschiedlichem Funktionsumfang und ihnen ganz eigenen Workflows. Was zeichnet das Tool Flinga aus? Katrin Meyer sieht verschiedene Vorteile. Vor der Sitzung können am Whiteboard Inhalte hinterlegt und Einstellungen vorgenommen werden. Wie lässt sich die Whiteboard-Nutzung effektiv vorbereiten? Katrin Meyer gibt Einblick in ihr Vorgehen. Das Anwendungsbeispiel im Detail: Eine Live Exercise mit digitaler Unterstützung In der im R-Kurs durchgeführten Live Exercise überlegen sich die Studierenden konkrete Anwendungsbeispiele aus Wissenschaft und Alltag für die zuvor erlernten statistischen Methoden. Hierzu wurde ein Board vorbereitet, in dem jede Methode in einer eigenen Farbe abgebildet ist. Fügen die Studierenden nun eine Karte mit einem Beispiel hinzu, so erscheint diese in der Standardfarbe violett und bleibt zunächst keiner Kategorie zugeordnet. Die Kommiliton:innen können nun eine Karte mit einem Beispiel der aus ihrer Sicht passenden Methode zuordnen. Dazu verschieben sie die Karte zum Namen der Methode. Sind die Studierenden mit den Zuordnungen anderer nicht einverstanden, so können sie diese korrigieren. In einer Plenumsdiskussion werden für jedes Beispiel die Gründe für die jeweilige Zuordnung diskutiert. Korrekte Zuordnungen werden festgehalten indem auch die jeweiligen Karten entsprechend der für die Kategorie gewählten Farbe eingefärbt werden. Es kann auch der Text auf den Beispiel-Karten verändert werden, wenn das zur eindeutigen Zuordnung notwendig ist. Katrin Meyer erklärt das Vorgehen bei der Live Exercise. Durch die Diskussion wird dabei das Verständnis weiter vertieft und es werden ggf. Fehlvorstellungen korrigiert. Am Ende der Live Exercise steht somit eine ausführliche und auf Richtigkeit geprüfte Beispiel-Sammlung zu den verschiedenen Methoden. So erscheinen die abstrakten Konzepte hinter den Methoden greifbarer, alltagsnäher und lebendiger. Im Bildschirm-Mitschnitt wird das Vorgehen anhand der konkreten Beispiele sichtbar. https://www.co3learn.de/wp-content/uploads/2025/09/Screencast_Flinga_Live_Exercise_1_2.mp4 Teilnehmenden-Ansicht der Software Flinga. Der Mitschnitt wurde im Rahmen einer Hospitation in Katrin Meyers R-Kurs durch das Co³Learn-Team erstellt. Während der Besprechung der Ergebnisse entstandene Wartezeiten zwischen den Fragen sind gekürzt und das Video wurde beschleunigt. Musik: „Corporate Background Music“ von „original_soundtrack“. Die Nutzung des Boards nimmt auch Einfluss auf das Engagement der Studierenden. Katrin Meyer teilt ihre Erfahrungen. Es bleibt für Katrin Meyer als Lehrende mehr Zeit für Erklärungen, da die Studierenden aktiv die Bedienung des Boards übernehmen. Neben Flinga nutzte Katrin Meyer auch weitere Tools wie Particify und Kialo Edu in ihrer Lehre. Wir baten sie um ein Fazit zu ihren Erfahrungen mit dem Einsatz digitaler Tools. Mit diesem Fazit endet unser Einblick in die Lehre von Katrin Meyer. Wir freuen uns, dass die verwendeten kollaborativen digitalen Tools zum Gelingen der Lehre beitragen konnten und auch durch Studierende positiv bewertet wurden. Weitere Einblicke, Erfahrungsberichte, Interviews und Anwendungsideen zu digital unterstützter Lehre finden sich im Dossier „Digitale Kollaboration“. Wir bedanken uns herzlich bei Katrin Meyer und ihren Studierenden, die diesen Einblick möglich gemacht haben! Autorinprofil Dr. Katrin Meyer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Forstwissenschaft und Waldökologie an der Georg-August-Universität Göttingen. Neben ihren inhaltlichen Schwerpunkten der theoretischen Ökologie, ökologischen Modellierung, Biodiversitätstheorie, Statistik und dem wissenschaftlichem Arbeiten definiert Meyer auch didaktische Schwerpunkte für ihre Lehre. Meyer konzentriert sich besonders auf die Studierendenorientierung, Interaktion & Aktivierung, Theorie-Erlebnisse, das forschende Lernen und das projektorientierte Lernen. Für ihre Lehre an der Universität Göttingen erhielt Meyer 2021 den renommierten Ars legendi-Fakultätenpreis im Bereich der Biowissenschaften, der exzellente Hochschullehre in den Naturwissenschaften und der Mathematik auszeichnet. Hinweis: Im Whiteboard werden u.a. die Markennamen von Zahnpflegeprodukten verwendet. Hierbei handelt es sich um geschützte Marken, die Rechte an den Markennamen liegen bei den Herstellern. Die Verwendung dient ausschließlich der Illustration der betreffenden Beiträge und verfolgt keine kommerziellen Interessen.
Wenn Mathe auf Messenger trifft und Instagram zum Lehrmittel wird
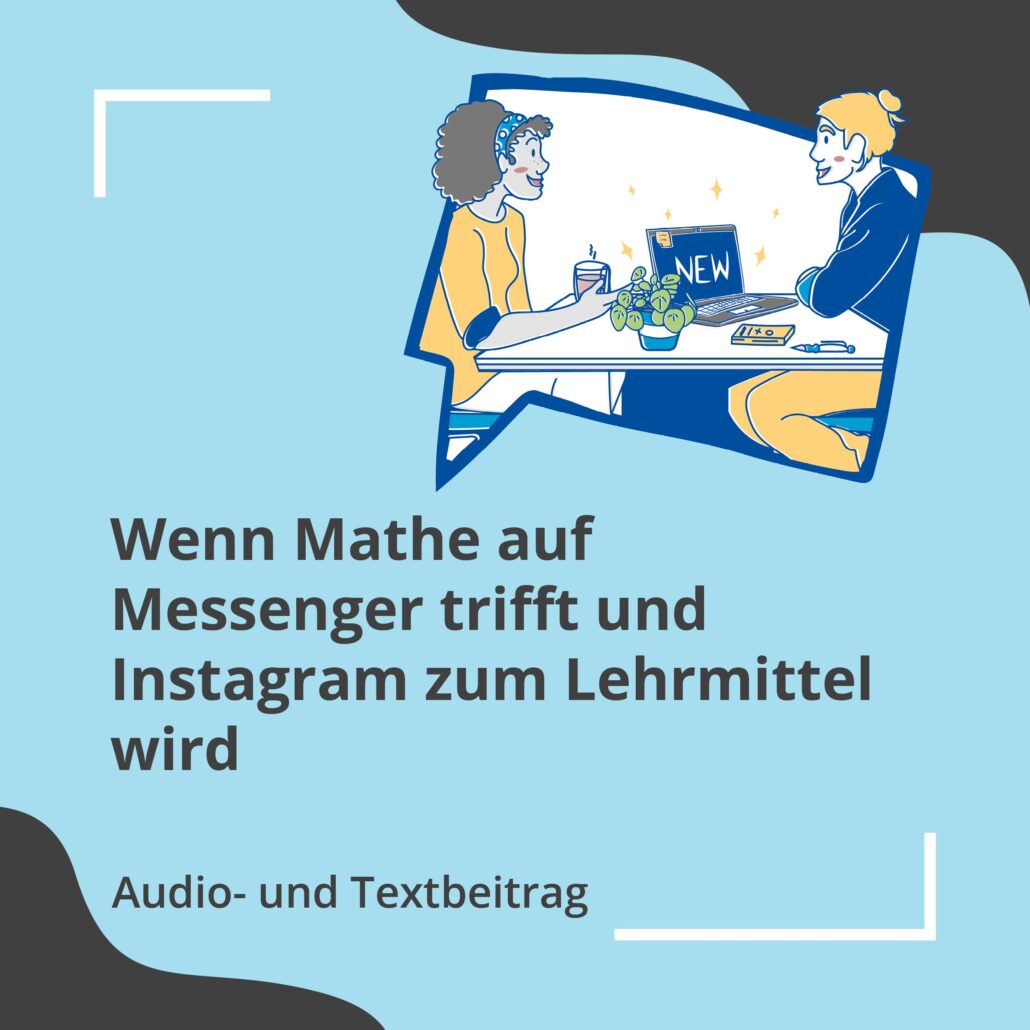
Wenn Mathe auf Messenger trifft und Instagram zum Lehrmittel wird Interview mit Dr. Florian Leydecker von Nadine Maxrath und Katharina Stimming Einblicke von Dr. Florian Leydecker in seine Erfahrungen zu unterschiedlichen Kommunikationswegen Dr. Florian Leydecker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Angewandte Mathematik an der Leibniz Universität Hannover. Er lehrt Mathematik für Wirtschaftswissenschaft sowie numerische Mathematik für Ingenieur*innen und wurde bereits mehrfach mit dem Preis für exzellente Lehre ausgezeichnet. In seiner Lehre ist ihm besonders wichtig, mit seinen Studierenden im guten Austausch zu bleiben und offen für neue Formate und Techniken zu sein. Dafür hat er schon einiges ausprobiert und teilt seine Erfahrungen im nachfolgenden Interview. Gerade in Großveranstaltungen ist Dr. Florian Leydecker aufgefallen, dass Studierende zwar aufmerksam zuhören, sich aber eher passiv verhalten. Aus diesem Grund begann der Mathematiker, mit verschiedenen Methoden zu experimentieren, um Studierende stärker einzubeziehen – unter anderem mit Clickerfragen und digitalen Wortwolken über das Tool Wooclap. Seiner Erfahrung nach, schätzen Studierende die Abwechslung durch diese Methoden und beteiligen sich gerne an Umfragen. Zu Beginn des Corona-Lockdowns startete er einen Instagram-Kanal, um nahbar zu bleiben und mit seinen Studierenden in Kontakt zu sein. Auf diesem Kanal zeigt er neben fachlichem Input auch Einblicke in seinen Alltag und ist über den Messenger direkt erreichbar. Sein Fazit: Die Hemmschwelle, Fragen zu stellen ist spürbar gesunken. Niedrigschwelligkeit, schneller Zugang und Nutzungsgewohnheit und die mediale Alltagsnutzung sind für ihn entscheidende Faktoren, die Wahl dieses Kanals als Kommunikationsweg begünstigen und erklären weshalb Studierenden so positiv auf seinen Instagram-Auftritt reagiert haben. Digitale Tools sind aus Sicht des Mathematikers eine sinnvolle Ergänzung zur Präsenzlehre, insbesondere wenn es um Kommunikation, Austausch und Aktivierung geht. Auch für Lerngruppen bieten digitale Tools zeit- und ortsunabhängige Möglichkeiten, sich zu organisieren. Entscheidend, um Studierende zu motivieren, ist aus seiner Sicht vor allem die eigene Begeisterung für das Fach und für die Lehre. Fragen wertschätzend zu beantworten und Studierenden auf Augenhöhe zu begegnen, kann dazu beitragen, Hemmungen abzubauen. Für neue Impulse in sucht er regelmäßig den Austausch mit anderen Lehrenden auch über die eigene Hochschule hinaus. Wer Interesse hat, sich weiter zum Thema auszutauschen, ist herzlich eingeladen, sich bei Nadine Maxrath oder Dr. Florian Leydecker zu melden. Nachfolgend ist das gesamte Interview in Abschnitten aufgeteilt zu finden: 300 Studierende erreichen und begeistern Dr. Florian Leydecker ist bekannt für seine Offenheit gegenüber neuen Lehrmethoden und seinen besonderen Draht zu Studierenden. Im Gespräch berichtet er, wie es ihm gelingt, seine Lehrveranstaltungen kontinuierlich weiterzuentwickeln – mit dem Ziel, Studierende stärker einzubeziehen, zur aktiven Teilnahme zu motivieren und eine lebendige Lernatmosphäre zu schaffen. Dabei spricht er auch über konkrete Methoden wie Clickerfragen oder digitale Wortwolken, die helfen, selbst in großen Vorlesungen echte Beteiligung zu fördern. 0:00 / 0:00 Interview Part 1 Kapitel 300 Studierende erreichen und begeistern Über den Mut Fragen zu stellen und die Verantwortung sichere Räume zu schaffen Kommunikation, die ankommt Über Anonymität und digitale Räume, die Nähe ermöglichen Dort erreichbar sein, wo Studierende eh schon sind: Warum Instagram wirkt Matrix in der Lehre: Zwischen Neugier und digitaler Realität Gemeinsam statt einsam: Wie Lern-Communities Studierende verbinden Zweite Chance mit neuen Ideen Digitale Tools als starke Begleiter der Präsenzlehre – Was noch besser werden kann Studierende motivieren und mitnehmen Austausch unter Lehrenden zur Weiterentwicklung der Lehre Abschluss Autorinnenprofil Profil Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen 12# Wissensnugget – Winterpause 11# Wissensnugget – Chat AI als Lernbuddy Instagram als projektbegleitende Kommunikationsplattform für studentische Beteiligung Kategorien Aktuelle Veranstaltungen Allgemein How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Über den Mut Fragen zu stellen und die Verantwortung sichere Räume zu schaffen Dr. Florian Leydecker und Nadine Maxrath gehen der Frage nach, was gelungene Wissensvermittlung ausmacht und wie echter Austausch mit Studierenden gelingen kann. Im Fokus stehen dabei die gegenseitige Bereitschaft zum Dialog in der Lehre, ein wertschätzender Umgang auf Augenhöhe sowie die Bedeutung von Offenheit und Mut. Sie sprechen darüber, warum Lehrende nicht nur Inhalte vermitteln, sondern auch Räume halten sollten, in denen Studierende sich sicher fühlen, Fragen zu stellen und aktiv mitzudenken. 0:00 / 0:00 Interview Part 2 Kommunikation, die ankommt Welche Kanäle eignen sich, um mit Studierenden in echten Austausch zu treten? Dr. Florian Leydecker berichtet von seinen Erfahrungen mit klassischen Plattformen wie dem Stud.IP-Forum, E-Mail und neuen Wegen über Instagram oder den Messenger Matrix. Im Fokus steht die Frage, wie Kommunikation niedrigschwellig, wertschätzend und wirksam gestaltet werden kann – damit Studierende sich trauen, Fragen zu stellen und in den Dialog zu gehen. 0:00 / 0:00 Interview Part 3 Über Anonymität und digitale Räume, die Nähe ermöglichen Dr. Florian Leydecker gewährt Einblicke in seine Lehre und erzählt, wie Instagram für ihn zu einem wertvollen Kommunikationskanal geworden ist. Mit persönlichen Inhalten zeigt er sich als Mensch hinter dem Dozierenden – und schafft damit Nähe, Vertrauen und echte Verbindung. Die Folge: Studierende verlieren Berührungsängste, suchen aktiv den Kontakt und stellen Fragen ganz direkt – oft samt Foto von Aufgaben oder konkreten Herausforderungen. 0:00 / 0:00 Interview Part 4 Dort erreichbar sein, wo Studierende eh schon sind: Warum Instagram wirkt Dr. Florian Leydecker spricht über die besondere Rolle von Instagram als direkter Draht zu seinen Studierenden. Die Plattform ermöglicht schnelle, unkomplizierte Kommunikation – oft mit einem Foto und einer kurzen Frage. Genau diese Vertrautheit mit dem Medium, die Möglichkeit zur Anonymität und der niedrigschwellige Zugang senken Hemmschwellen deutlich. Während sich Studierende in privaten Räumen wie WhatsApp oder Studydrive untereinander austauschen, schafft Leydecker über seine Kanäle bewusst offene, erreichbare Räume für Rückfragen – transparent, freiwillig und ohne Bewertung. 0:00 / 0:00 Interview Part 5 Matrix in der Lehre: Zwischen Neugier und digitaler Realität Dr. Florian Leydecker wagt den Blick hinter ein ehrliches Experiment: Mit dem Open-Source-Messenger Matrix wollte er eine einfache, sichere und direkte Kommunikation mit seinen Studierenden schaffen. Trotz technischer Vorteile wie der Verknüpfung mit Stud.IP und der mobilen Erreichbarkeit blieb der erhoffte Austausch – etwa über gemeinsame Klausuraufgaben – aus. Warum? Hohe Belastung, Zeitmangel und vielleicht auch Gewohnheiten im digitalen Alltag der Studierenden standen dem Engagement entgegen. Leydecker reflektiert offen über den Zwiespalt zwischen Korrektur und Diskussion und zeigt, wie
Ein Blick in den Seminarraum: Debattieren mit Kialo Edu
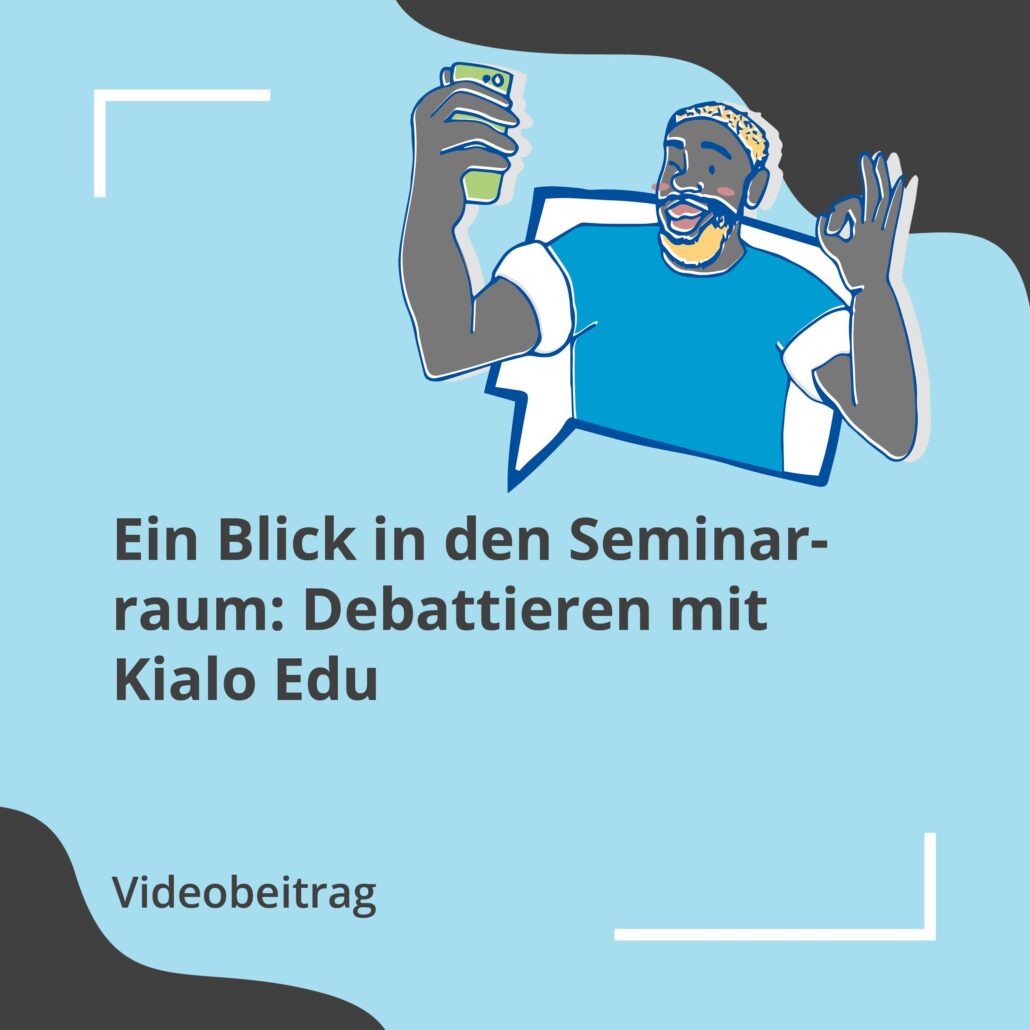
Ein Blick in den Seminarraum: Debattieren mit Kialo Edu von Katrin Meyer & Verbundprojekt Co³Learn Im Wintersemester 2023/24 führte die Göttinger Lehrende Katrin Meyer eine Digitale Debatte im Rahmen einer Lehrveranstaltung zur Biodiversitätstheorie durch. Das Projekt Co³Learn durfte sie dabei begleiten. Im Video gibt es einen Einblick in das Debatten-Tool Kialo Edu, didaktische Überlegungen zur Digitalen Debatte und die Umsetzung der Debatte im Seminarraum. Wir erfahren Katrin Meyers Fazit – und wie die Studierenden auf die Debatte und das Tool Kialo Edu reagiert haben. https://www.co3learn.de/wp-content/uploads/2025/06/Kialo_Edu_Katrin_Meyer.mp4 Intro-Musik: „Heartfelt journey“, Universfield auf Freesound Herzlichen Dank an Katrin Meyer für die Möglichkeit, die Debatte zu begleiten, und für die spannenden Einblicke! Ein Überblick und weiteres Material zum Thema „Digitale Debatte“ anhand ausgewählter didaktischer Szenarien und konkrete Tipps zum Umgang mit Kialo Edu finden sich hier. Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen Ein Blick in den Seminarraum: Debattieren mit Kialo Edu 6# Wissensnugget – KI trifft Lehre Zwischen Studium und Verbundprojekt Kategorien Aktuelle Veranstaltungen How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Autorinprofil Dr. Katrin Meyer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Forstwissenschaft und Waldökologie an der Georg-August-Universität Göttingen. Neben ihren inhaltlichen Schwerpunkten der theoretischen Ökologie, ökologischen Modellierung, Biodiversitätstheorie, Statistik und dem wissenschaftlichem Arbeiten definiert Meyer auch didaktische Schwerpunkte für ihre Lehre. Meyer konzentriert sich besonders auf die Studierendenorientierung, Interaktion & Aktivierung, Theorie-Erlebnisse, das forschende Lernen und das projektorientierte Lernen. Für ihre Lehre an der Universität Göttingen erhielt Meyer 2021 den renommierten Ars legendi-Fakultätenpreis im Bereich der Biowissenschaften, der exzellente Hochschullehre in den Naturwissenschaften und der Mathematik auszeichnet.
Communitybuilding für Communitybuilder
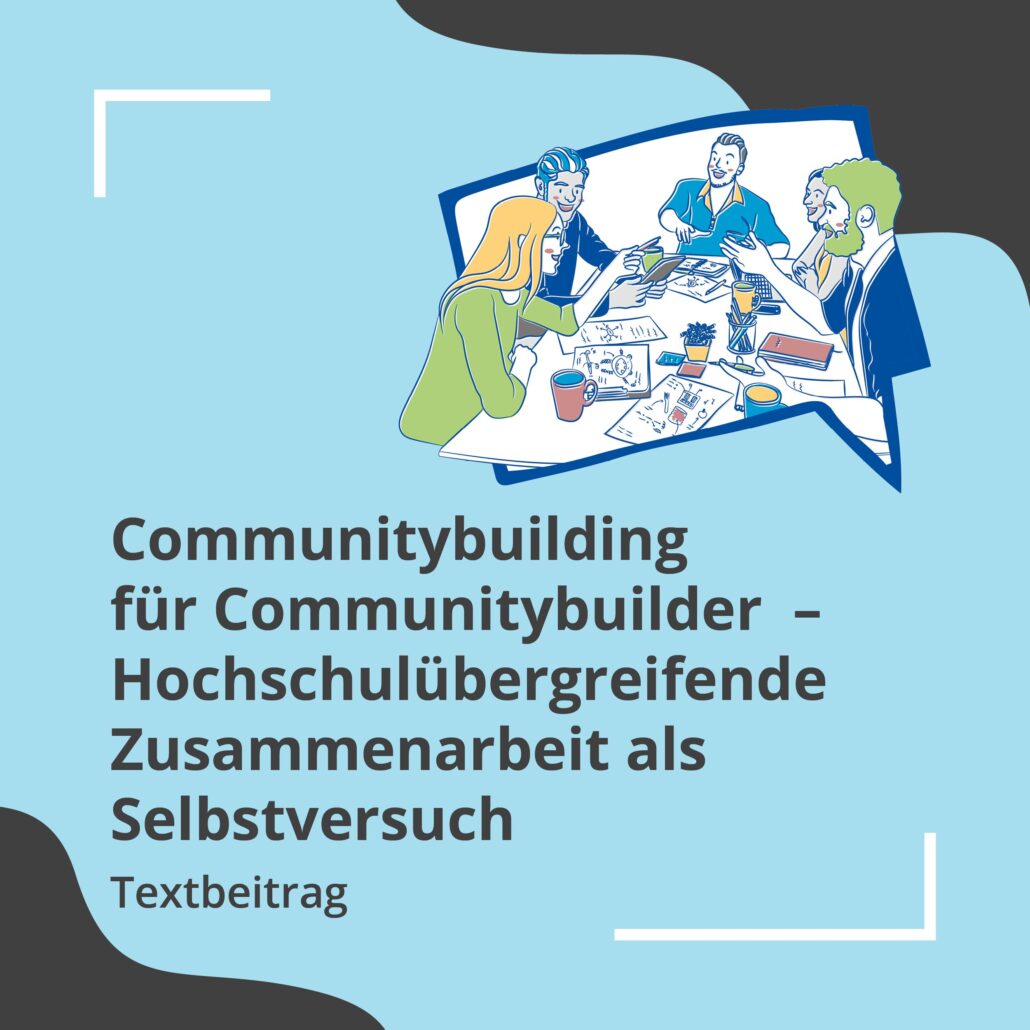
Communitybuilding für Communitybuilder Hochschulübergreifende Zusammenarbeit als Selbstversuch von Dr. Katja Franz, Lars Gerber, Anna Sophie Jäger, Anna Scarcella, Johanna Springhorn, Sabrina Zeaiter, Sven Zulauf In diesem Beitrag wollen wir anhand der Erfahrungen aus unserer dreijährigen Arbeit als Community of Practice, der Art unseres Zusammenarbeitens und wie wir in Zukunft zusammenarbeiten werden, zeigen, wie Kollaboration und Kooperation in einem freiwilligen Zusammenschluss von motivierten Personen aussehen kann. Die Besonderheit und Stärke unserer Community bestehen darin, dass wir uns bundesweit anhand unserer thematischen Ausrichtung und Aufgaben zusammengefunden haben. Wir haben uns einen eigenen inhaltlichen und technischen Rahmen gegeben und bringen aufgrund der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Hochschultypen vielfältige Sichtweisen und differenziertes Erfahrungswissen mit. Ein wichtiges Ziel unseres Beitrags besteht daher darin, zu verdeutlichen, wie gewinnbringend uns die Vernetzung über das eigene Projekt und auch die eigene Hochschule hinaus erscheint, um gemeinsam das Lehren und Lernen der Zukunft mitzugestalten. Kooperation zwischen Lehrenden sowie der Austausch von Ideen und Materialien rund um die Lehre sind an Hochschulen keine Selbstläufer. Als Mitarbeiter*innen verschiedener Hochschulen in Einzel- und Verbundprojekten, die von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert werden, widmen wir uns der Herausforderung des Communitybuildings. Unser Netzwerk umfasst Hochschuldidaktiker*innen und andere Mitarbeitende aus dem Third Space, die das Ziel verfolgen, Communities von Lehrenden und Studierenden in der einen oder anderen Form zu initiieren, zu begleiten und zu stabilisieren. So haben wir eine Community of Practice „Communitybuilding für Communitybuilder“ gegründet und stehen seit Ende 2022 im kontinuierlichen Austausch. In unserer Zusammenarbeit stellen wir uns insbesondere die folgenden Fragen: Wie und wodurch kann Communitybuilding für Lehrende und Studierende ein gewinnbringender Teil der Hochschullehre sein/werden? Welche Herausforderungen entstehen für uns als Communitybuilder? Wie können wir unseren Zielgruppen den Mehrwert von Kooperation in Lehr-Lernnetzwerken näherbringen? Wie kann eine angemessene Begleitung von Lehr-Lerncommunities durch Unterstützung aus dem Third Space aussehen? Grundlagen unserer Community: Freiwillige und ko-kreative Zusammenarbeit Unsere Community basiert auf einem starken Fundament intrinsisch motivierter Beteiligter. Unsere Zusammenarbeit wird von äußeren Rahmenbedingungen und inneren Werten geprägt. Die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Hochschulformen – von Universitäten über Fachhochschulen bis hin zu Technischen Hochschulen bzw. Universitäten – bereichert unsere Zusammenarbeit und ermöglicht einen breiten Austausch von Perspektiven und Praktiken. Ursprünglich setzte sich unsere Community aus von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre geförderten Projekten der Förderlinie „Hochschullehre durch Digitalisierung stärken“ zusammen. Die im Rahmen der TURN 2022 gewonnene Erkenntnis, mit ähnlichen Aufgaben zur Vernetzung von Lehrenden und Studierenden betraut zu sein, bildete den Auftakt dieser Community. Unsere überwiegend digitale Zusammenarbeit wird durch ein jährliches Präsenztreffen ergänzt, welches den persönlichen Austausch fördert und vertieft. Kapitel Grundlagen unserer Community: Freiwillige und ko-kreative Zusammenarbeit Formate der Zusammenarbeit innerhalb der Community Digitale Tools im Spiegel institutioneller Rahmenbedingungen Zusammenarbeit als Community: Hochschullehre weiterdenken Autor*innenprofile Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen 12# Wissensnugget – Winterpause 11# Wissensnugget – Chat AI als Lernbuddy Instagram als projektbegleitende Kommunikationsplattform für studentische Beteiligung Kategorien Aktuelle Veranstaltungen Allgemein How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen In unserer Community ist Ko-Kreation ein zentrales Prinzip, das wir in der Zusammenarbeit bewusst leben. Das von- und miteinander Lernen auf Augenhöhe ist uns ein fundamentaler Wert. Wir verzichten bewusst auf Hierarchien und feste Leitungsstrukturen, stattdessen setzen wir auf geteilte und rotierende Verantwortung und Eigeninitiative. Diese Struktur ermöglicht es uns, flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, fördert den hochschulübergreifenden Austausch und produziert Beiträge zur Forschungs- und Entwicklungslandschaft. Unsere Prinzipien der Selbstorganisation und Freiwilligkeit sorgen dafür, dass auch neue Mitglieder jederzeit willkommen sind und sich einbringen können. Auch wenn uns projektbasierte Strukturen und dadurch bedingte Fluktuationen vor Herausforderungen stellten, ist uns in den letzten drei Jahren eine fruchtbare und kontinuierliche Zusammenarbeit gelungen. Durch klare Nachfolgeregelungen und die intrinsische Motivation unserer Mitglieder, sich weiter zu engagieren – unabhängig von ihrer aktuellen Position oder Hochschule – können und konnten wir diese Veränderungen in der Community immer wieder gut auffangen. Formate der Zusammenarbeit innerhalb der Community Unsere Community haben wir als dynamischen Raum gestaltet. Gemeinsam arbeiten wir an der Förderung von Communitybuilding und Lehr-Lernnetzwerken. Neben dem Austausch über unsere jeweiligen Netzwerkformate diskutieren wir übergreifende Themen und Fragestellungen, Probleme und Lösungsansätze. Dieser Erfahrungs- und Wissensaustausch wird in verschiedenen Formaten realisiert, die unsere Zusammenarbeit strukturieren und effektiv gestalten. Dabei gehen wir jeweils zielorientiert vor: 1. Präsenztreffen Auftakttreffen Bei diesem ersten Präsenztreffen im Juni 2023 kamen zwölf Personen aus elf Hochschulen für ein erstes Kennenlernen am Lehrenden-Service-Center der HTW Berlin zusammen. Es wurden die jeweiligen Projekte vorgestellt mit Fokus darauf, wie wir Lehrende (und Studierende) für den Austausch über Lehren und Lernen zusammenbringen können. Darüber hinaus haben wir gemeinsame Herausforderungen wie die Limitierung durch Fach- und Hochschulstrukturen, gesammelt. Ziel war es, erste Lösungsideen für diese zu entwickeln und den Grundstein für unsere weitere Zusammenarbeit zu legen. Anschlusstreffen Unser zweites Präsenztreffen im April 2024 fand an der Philipps-Universität in Marburg statt. Es diente einerseits dazu, die thematische Arbeit zu vertiefen, das heißt unter anderem grundsätzliche Themen zu diskutieren, wie beispielsweise den Unterschied zwischen „Community“ und „Netzwerk“. Andererseits nutzten wir das Treffen dazu, unsere Zusammenarbeit durch Publikationen und Veranstaltungsbeiträge, wie einen Beitrag für das University Future Festival 2024 (U:FF), weiterzuentwickeln. Treffen auf Tagungen und Konferenzen Wir nutzten verschiedene Konferenzen, wie z.B. die TURN 2023 und 2024 sowie die HFDCon 2024 als Anlass, neue Impulse für die Zusammenarbeit in unserer Community zu erhalten und uns vor Ort fachlich und themenbezogen, aber auch auf persönlicher Ebene, auszutauschen. 2. Regelmäßige Videokonferenzen Unsere Zusammenarbeit führen wir in synchronen Onlinetreffen fort, die etwa alle 4-6 Wochen stattfinden. Bei diesen regelmäßigen Austauschtreffen werden Ideen geteilt und gemeinsam Lösungen für individuelle und standortübergreifende Herausforderungen entwickelt. Neben der Vorstellung und Diskussion der jeweiligen Formate (z.B. MarSkills Forum, BiLinked LehrBar und studentische Austauschtreffen, Tag der Last-Minute Lehrvorbereitung von Co³Learn, Interdisziplinärer Marktplatz von InDiNo, didakTISCH von ViBeS) bieten wir uns gegenseitig kollegiale Beratungen, arbeiten an Entwürfen für Tagungsbeiträge oder kollaborativ an gemeinsamen Texten. Screenshot aus einer Videokonferenz mit Sven Zulauf, Anna Sophie Jäger, Anna Scarcella, Johanna Springhorn, Dr. Katja Franz, Lars Gerber, Sabrina Zeaiter (v. links oben) 3. Aktive Teilnahme an Fachdiskurs und Erkenntnistransfer Beim U:FF 2024 (University Future Festival) beteiligten
Vom Insta-Scroll zum Zoom-Call

Vom Insta-Scroll zum Zoom-Call: Mein unerwartetes Interview mit Christian Spannagel und über die Vorteile von Offenheit in der Hochschullehre von Nadine Maxrath Im Interview spricht Prof. Dr. Christian Spannagel darüber, wie er digitale Tools gezielt einsetzt, um innovative Lehransätze wie die Verbindung von Inverted Classroom und HyFlex voranzutreiben. Dabei zeigt er, wie er traditionelle Präsenzlehre mit digitalen Ansätzen kombiniert und kollaborative Prozesse unter Studierenden fördert. Ein spannendes Gespräch voller praxisnaher Einblicke! Manchmal nehmen die besten Dinge ganz unerwartet ihren Lauf. Morgens, auf dem Weg zur Arbeit, saß ich in der Bahn und scrollte durch Instagram, als mir ein Video von Prof. Dr. Christian Spannagel angezeigt wurde. Mein erster Gedanke: Ach cool, der wäre genau der Richtige, um unser Projekt bekannter zu machen und die Aufmerksamkeit anderer Lehrender zu gewinnen. Ohne lange zu überlegen, tippte ich eine Nachricht an Prof. Spannagel und erzählte kurz von unserem Projekt. Beim Abschicken dachte ich noch: Das gibt eine Absage oder die Bitte, eine offizielle Anfrage zu stellen. Doch kurz darauf die Überraschung: „Ja klar, wollen wir dazu mal zoomen?“ – damit hatte ich nicht gerechnet! Nach einem ersten Treffen und Klärung offener Fragen vereinbarten wir direkt einen Termin zum Interview. Gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Henrike Neubauer trafen wir uns online, und es wurde ein sehr angenehmes Gespräch, bei dem ich mein Interesse, aus Zeitgründen, mehr als einmal zurückhalten musste. Prof. Spannagel wusste immer genau, worauf ich mit meinen Fragen hinauswollte. Aber besonders beeindruckt hat mich seine Offenheit, als es um die Herausforderungen in der Lehre ging. Er sprach ehrlich und direkt darüber, wo es hakt – etwas, das oft vermieden wird. Jedoch ist diese Ehrlichkeit wichtig, denn sie öffnet den Raum für echte Lösungen. Was dieses Interview mir gezeigt hat Rückblickend hat mich dieses Interview nicht nur inhaltlich bereichert, sondern auch die Stärken digitaler Kooperation auf beeindruckende Weise vor Augen geführt. Es zeigte erneut, wie viel wir erreichen können, wenn wir unsere lokalen Hochschulgrenzen überwinden und uns auf digitale Werkzeuge einlassen und dass wir vielleicht auch etwas lernen müssen. Die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind enorm: Wir können uns unkompliziert und schnell mit Menschen vernetzen, die wir vielleicht nie persönlich getroffen hätten. Zeit- und Ortsunabhängigkeit machen es möglich, mit wenig Aufwand spannende Gespräche zu führen und wertvolle Impulse zu gewinnen. Der Austausch über verschiedene Perspektiven bereichert und öffnet neue Lösungsräume – gerade bei Herausforderungen, die uns alle betreffen. Noch wichtiger: Es hat mir gezeigt, wie viel wir gewinnen können, wenn wir mit Offenheit und Neugier auf andere zugehen. Schwierigkeiten und Herausforderungen müssen kein Hindernis sein, sondern können durch ehrlichen Austausch in Chancen verwandelt werden. Für mich war dieses Interview ein voller Erfolg – und ich hoffe, dass es auch die Zuschauer*innen inspiriert, die Potenziale digitaler Zusammenarbeit zu nutzen und offen für neue Wege in der Lehre zu sein. Kapitel Direkt zum Videobeitrag Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen Vom Insta-Scroll zum Zoom-Call Virtuelle Zusammenarbeit verstetigt etablieren Kollaborative Lehrveranstaltungen gemeinsam umsetzen Kategorien How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen https://www.co3learn.de/wp-content/uploads/2025/01/Spannagel_final_mp4_kleine_Version.mp4 Wer jetzt noch Interesse hat, sich mit Prof. Dr. Christian Spannagel zu vernetzen, der besucht die Seite der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und findet mehr als einen Weg. Ein kurzer Hinweis auf dieses Interview wäre hilfreich. https://www.ph-heidelberg.de/mathematik/personen/lehrende/spannagel/ Und wer Lust hat, digitale Tools kreativ in ihrer/seiner Lehre einzusetzen, die/der vernetzt sich mit uns und unserer Community und kommt zu den monatlichen Online-Treffen: https://www.co3learn.de/community/
Verbundarbeit im Fokus – Koordination, Qualitätssicherung und Zusammenarbeit im Projekt QUADIS
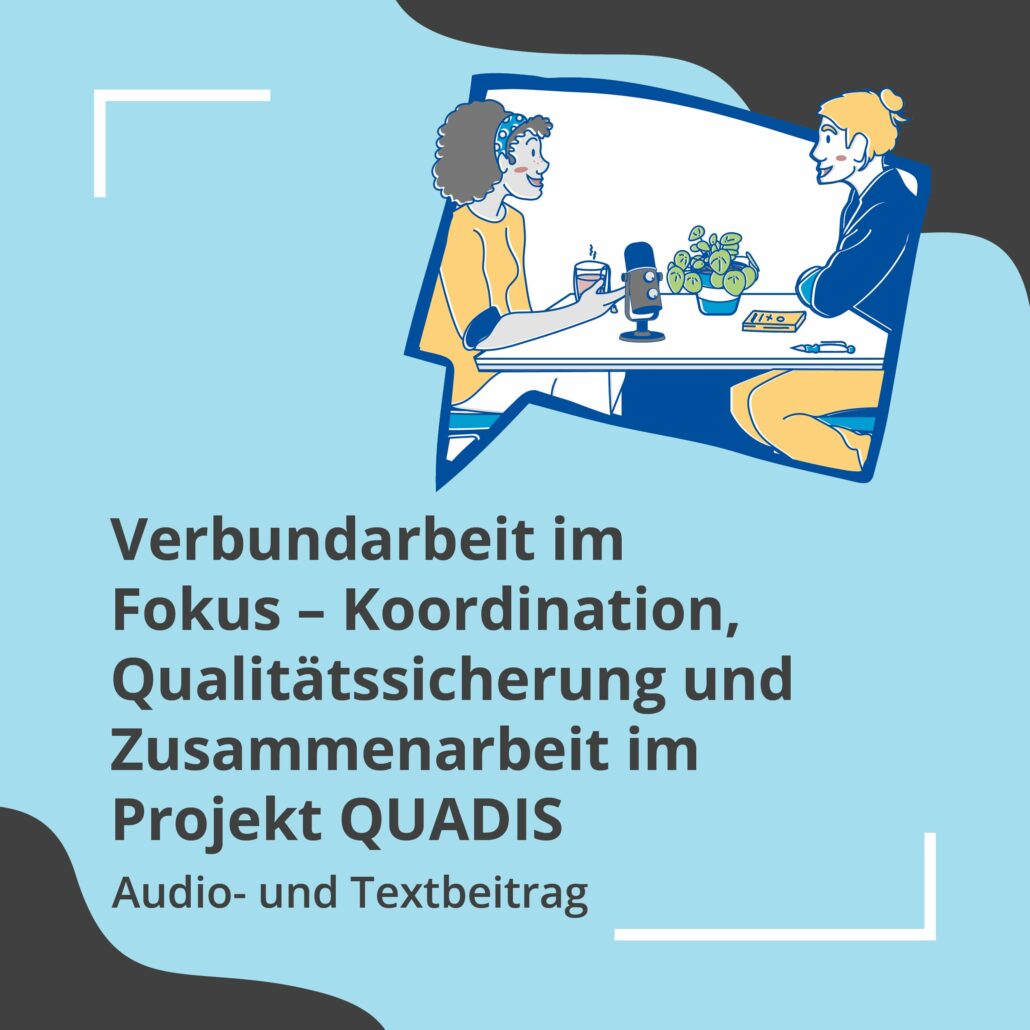
Verbundarbeit im Fokus – Koordination, Qualitätssicherung und Zusammenarbeit im Projekt QUADIS Interview mit Julia Rupprecht Julia Rupprecht arbeitete als Koordinatorin im Verbundprojekt QUADIS und berichtet im Interview über ihre Erfahrungen in der Koordination mit verschiedenen Methoden und Formaten der Zusammenarbeit. Dieses Verbundprojekt agierte bayernweit und hat die hochschuldidaktische Weiterbildung auf einem hohen Qualitätsniveau digitalisiert und flexibilisiert. QUADIS umfasste 15 Projektpartner und bestand aus drei Säulen: Die erste Säule war die Entwicklung von Open Educational Resources (OER): zweisprachige Blended-Learning-Seminare (Deutsch und Englisch) mit hohen Barrierefreiheitsstandards Kombination von Online- und Präsenzphasen mit breitem Themenspektrum Integration der Seminare in das Zertifikat Hochschullehre Bayern für eine bayernweit hohe Qualitätsstandardisierung sowie ein gesteigertes Kursvolumen Umsetzung eines Evaluationskonzepts (Begleitung von Trainer*innen und teilnehmenden Lehrpersonen) Die zweite Säule war die Intensivierung des Diskurses zu Themen der digitalisierten Hochschullehre: QUADIS organisierte Symposien in unterschiedlichen Formaten (digital, hybrid und in besonderen Veranstaltungsorten) und etablierte Fach- und Arbeitsgruppen. Die dritte Säule bildeten die sogenannten Lehrwerkstätten: Lehrende aller Fachrichtungen erarbeiteten gemeinsam und unter professioneller Anleitung von Hochschuldidaktiker*innen neue und innovative Konzepte für die eigene Lehre Evaluation dieser Maßnahmen zur professionellen Transferunterstützung von Lehrenden, um evidenzbasierte Empfehlungen für die methoden- und formatspezifische Ausgestaltung geben zu können Skalierung im Verbund Sophie: Wie hast du diese drei Säulen in deiner Arbeit als Koordinatorin verbunden? Julia: Meine Stelle war beim Universität Bayern e.V. angesiedelt, was die bayerische Universitätenkonferenz ist. Im Verbundprojekt fungierte ich als Schnittstelle zwischen verschiedenen hochschuldidaktischen Netzwerken in Bayern. Dazu gehörten ProfiLehrePlus (PLP) – das Netzwerk der hochschuldidaktischen Einrichtungen der bayerischen Universitäten, BayZiel – Bayerisches Zentrum für Innovative Lehre und die Virtuelle Hochschule Bayern (vhb), die verantwortlich für die Verbreitung und das Hosting unserer OER-Materialien war. Als eines der größten Projekte, das von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wurde, war eine zentrale Koordination zwingend erforderlich. Meine Aufgabe war die Planung, Koordination und Dokumentation aller Projektprozesse, um eine reibungslose Zusammenarbeit und Zielerreichung sicherzustellen. Außerdem habe ich die Standorte bei der Bewältigung von Herausforderungen unterstützt, um das Projekt erfolgreich zu steuern. Sophie: Welche Grundlage und Werte gab es für die Zusammenarbeit dieser vielen Standorte und aus diesen großen Bereichen? Julia: Wir können glücklicherweise sagen, dass das Verbundprojekt QUADIS auf einer länger bestehenden Kooperation aufgesetzt hat. ProfiLehrePlus (PLP) kooperierte bereits vor diesem Projekt mit dem damaligen Didaktikzentrum Bayern – jetzt Teil des BayZiel. Es bestanden also schon langjährig gefestigte, sehr gute Verbindungen und uns einte dieses gemeinsame Ziel: Hochschullehre an unseren Standorten gemeinsam weiterzuentwickeln. Da wir auf dieser guten Verbindung aufbauen konnten, war kollegiale, sehr lösungsorientierte Zusammenarbeit etwas, das uns schon vorher geeint hat. Zusätzlich haben wir uns gefragt, was zeitgemäße Lehre erfordert. Deswegen war QUADIS ein Verbundprojekt, was in dieser Form sogar noch vor der Corona-Pandemie beantragt wurde. Es war keine Reaktion auf Corona, sondern im Gegenteil – weil wir diese starke Zukunftsorientierung hatten, war klar: Digitalität ist das beherrschende Thema in den nächsten Jahren. Kapitel Onboarding, Teamentwicklung und -struktur im Projektverlauf Entstehung des Critical-Friends-Verfahrens Corona-Pandemie und KI als neuer Antrieb Weiterführende Links Autorinnenprofil Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen Vom Insta-Scroll zum Zoom-Call Virtuelle Zusammenarbeit verstetigt etablieren Kollaborative Lehrveranstaltungen gemeinsam umsetzen Kategorien How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen 0:00 / 0:00 Onboarding, Teamentwicklung und -struktur im Projektverlauf Sophie: Kannst du bitte zwei Formen oder Formate eurer Zusammenarbeit vorstellen, von denen du sagst, dass diese in deiner Laufbahn als Koordinatorin richtig gut funktioniert haben? Mit welchen Tools habt ihr dabei gearbeitet? Julia: Unsere Hauptkommunikation lief asynchron über das Tool Mattermost des Hochschulforums Digitalisierung (HFD) in thematisch strukturierten Kanälen. Für verschiedene Arbeitsgruppen und Medienproduktion haben wir uns täglich dort ausgetauscht und konnten auch auf frühere Chats und Dokumente zugreifen. Mattermost bot zudem eine Anbindung an die größere Hochschuldidaktik-Community. Was sich für uns bewährt hatte, war das Arbeiten in Sub-Teams, die bei Bedarf eigene Meetings organisieren. Beispielsweise beschäftigte sich eine Arbeitsgruppe mit Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Solche Gruppen bearbeiteten eigenverantwortlich verschiedene Projektprozesse. Jede Gruppe hatte eine*n Hauptansprechpartner*in, der*die die Organisation übernahm und Informationen im wöchentlichen Jour Fixe weitergab. Diese Struktur bewährte sich ebenfalls, da aufgrund der großen Anzahl von 20-25 Mitarbeitenden nicht jede*r überall dabei sein konnte. Es gab an jedem Standort eine Stelle für didaktische Mitarbeiter*innen und standortspezifisch noch Zusatzrollen, wie zum Beispiel Medienproduktion oder die Expertin für Barrierefreiheit. Auch wenn unsere digitale Zusammenarbeit gut verlief, waren Präsenztreffen essenziell. Wir haben ein- bis zweimal pro Jahr Mitarbeitenden-Konferenzen mit den QUADIS-Mitarbeiter*innen durchgeführt, um die inhaltliche Programmatik zu besprechen, Blended Learning Seminare zu planen und unsere Fortschritte zu bewerten. Diese zweitägigen Treffen beinhalteten auch Teambuilding-Maßnahmen, um die Zusammenarbeit zu verbessern und zukünftige Schritte zu planen. Zusätzlich gab es Konferenzen für die Arbeitsverantwortlichen – die Leitungen der hochschuldidaktischen Einrichtungen. Diese Gruppe hat strategische Themen und die Positionierung des Verbunds besprochen. Zusammengefasst: Mitarbeitenden-Konferenzen fokussierten sich auf operative und inhaltliche Themen, während Arbeitsverantwortlichen-Konferenzen die strategische Ausrichtung behandelten. Sophie: Welche Tools nutzt ihr neben Mattermost noch für die Zusammenarbeit? Julia: Mattermost als Kommunikationsplattform hat sich durch die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen damals als beste Möglichkeit erwiesen. Wir nutzten noch Zoom für synchrone Meetings, Trados für die Übersetzung, Unipark für die Evaluation und CryptPads (ähnlich Etherpads mit eigener Verschlüsselung) für jegliche Form von kollaborativen Schreibprozessen, bei denen schnell in Sub-Teams agiert werden musste. Die Kooperation der meisten Projektpartner war vorher zwar schon langjährig etabliert, jedoch eher auf den Austausch der Leitungsebene und ähnliche Themen bezogen. Im Projekt gab es nun viel stärker operatives Tagesgeschäft. Dafür mussten wir uns im Verbund auch Tools für die tägliche Zusammenarbeit geben, weil sonst die Gefahr bestanden hätte, dass jeder an seinem eigenen Standort bleibt und schaut, wie er die eigenen Probleme vor Ort löst. Wir haben so stark von diesem Austausch profitiert, insbesondere in der Qualitätssicherung, weil wir uns gegenseitig auch reviewt haben. Zum Beispiel hatten wir ein Critical–Friends-Verfahren, wofür wir diese Nähe in der Zusammenarbeit benötigt haben. Das wäre ohne die neuen Tools in der Form nicht möglich gewesen. Sophie: Was habt ihr genau in diesem Critical–Friends-Verfahren umgesetzt? Julia: Für die Produktion von Blended-Learning-Seminaren im OER-Format haben wir klare (didaktische, strukturelle und mediale) Qualitätsstandards definiert und in einer Handreichung zusammengefasst. Um sicherzustellen,
Toolunterstützte Entscheidungsfindung in standortübergreifenden Projektarbeiten
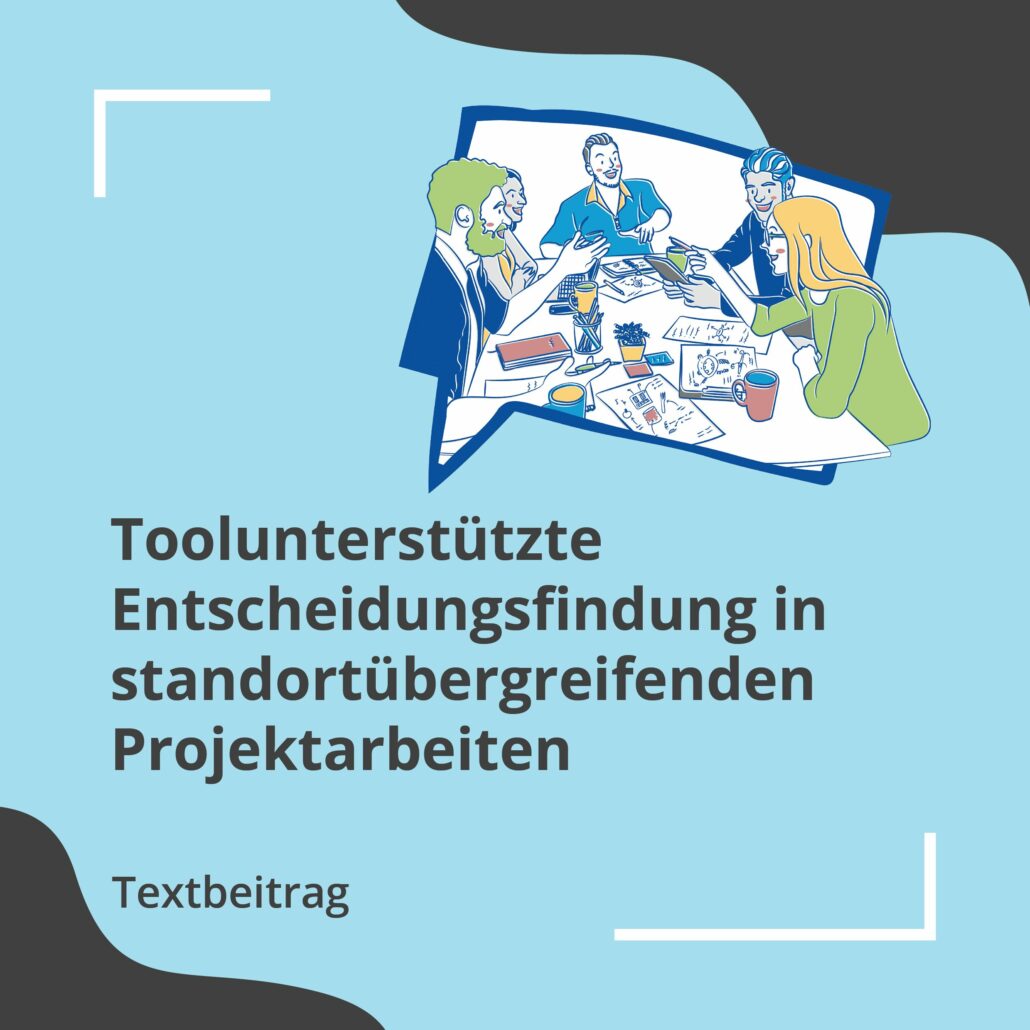
Toolunterstützte Entscheidungsfindung – in standortübergreifenden Projektarbeiten von Finn, Madeline, Michelle, Alia und Shubham Welche Tools können bei der Zusammenarbeit hilfreich sein? Stellt euch vor, ihr arbeitet bei einem großen deutschen Autokonzern und seid mit der Fertigstellung eines neuen Kleinwagenmodells beauftragt, erreicht euer Produktionswerk in China aber aufgrund der Zeitverschiebung nicht, um den aktuellen Stand der Produktion zu erfragen. Oder ihr sitzt an den letzten Zügen eurer Masterarbeit, die ihr mit einem Kommilitonen schreibt, der euch ständig minutenlange Sprachnachrichten auf WhatsApp mit Änderungswünschen für eure Arbeit schickt, durch die ihr schon lange nicht mehr durchsteigt. Oder ihr nehmt an einem standortübergreifenden Seminar in der Uni teil, für das ihr als Gruppe eine Prüfungsleistung erbringen müsst und einfach nicht wisst, wie ihr Struktur in eure zahlreichen und vielfältigen Ideen bringen könnt. Wie ihr seht, gibt es sowohl in der Uni als auch im späteren Arbeitsalltag immer wieder Situationen, in denen Zusammenarbeit mit anderen Menschen, ob vor Ort oder vielleicht sogar auf anderen Kontinenten verteilt, unerlässlich ist. Dabei birgt die Zusammenarbeit im Vergleich zum autonomen Arbeiten viele potenzielle Stolpersteine, die euer erfolgreiches gemeinsames Ergebnis schnell in weite Ferne rücken lassen können. Standortübergreifende Zusammenarbeit kann häufig mit weiten Entfernungen einhergehen, die nicht selten von Zeitverschiebungen begleitet werden und zu grundsätzlichen Problemen in der allgemeinen Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern führen können. Woher wollt ihr wissen, ob die Deadline eures Projekts eingehalten werden kann, wenn ihr seit zwei Wochen von der Hälfte der Arbeitsgruppe nichts mehr gehört habt? Hierbei könnte es zum einen an verbindlichen Absprachen in Bezug auf das regelmäßige Mitteilen des Arbeitsstandes mangeln. Andererseits könnte aber auch einfach eine Plattform fehlen, die den regelmäßigen und reibungslosen Austausch über Meilensteine im Projekt ermöglicht, damit weitere Arbeitsschritte nicht behindert werden oder in Verzug geraten. In anderen Fällen, wie z. B. dem oben erwähnten Schreiben einer Masterarbeit zusammen mit einer anderen Person, könnte ein Tool für die Kommunikation zwar bereits Verwendung finden, aber es wurde vermutlich im Vorfeld kein Kommunikationskodex festgelegt. Sprachnachrichten zu versenden scheint für die einen simpel und schnell zu funktionieren, für die anderen kann es jedoch zur Last werden, wenn ihr auch später noch einmal Vereinbarungen, Ideen, Lösungsvorschläge etc. nachvollziehen möchtet, die nicht in schriftlicher Form festgehalten wurden. Ein Tool, das einfach zu bedienen, für alle Teilnehmenden jederzeit nachvollziehbar und auch nach längerer Zeit noch verwendbar ist, könnte die Lösung für das Sprachnachrichten-Dilemma sein, das wohl jede*r schon einmal in einer Gruppenarbeit erlebt hat. Obwohl WhatsApp für die meisten als Kommunikationstool auf der Hand liegt, kann es sich lohnen, einmal andere Tools auszuprobieren. Nicht allein wegen der empfehlenswerten Trennung von privaten Nachrichten und derer, die im Uni- bzw. Arbeitskontext auf euren Endgeräten landen werden. Wenn ihr euch nun für ein Tool zur Projektkommunikation entschieden habt, so hat vermutlich trotzdem jede*r von euch unterschiedliche Vorstellungen, wie ihr dies nutzt. Hier kann es hilfreich sein, visuell zu arbeiten, um einen roten Faden für das Projekt zu finden. Um im weiteren Verlauf eurer Zusammenarbeit Struktur in das Projekt zu bekommen, sei es für einen ersten „Brain Dump“ oder die weiterführende Verteilung von anfallenden Aufgaben untereinander, kann es hilfreich sein Tools zu nutzen, mit denen ihr z.B. Mindmaps erstellen könnt. Und hierfür müsst ihr euch nicht einmal sehen, um die Ideen zu sammeln, da jede*r auf das Tool zugreifen, seine oder ihre Vorschläge loswerden und sich gehört fühlen kann. Apropos sich gehört fühlen – was gehört denn eigentlich dazu, dass sich jede*r in der Gruppe wohlfühlt und die Zusammenarbeit gelingt? Wichtige Komponenten für erfolgreiche Zusammenarbeit möchten wir euch im Folgenden an die Hand geben: Kapitel Was macht eine gute Zusammenarbeit aus? Welche Tools könnt Ihr nutzen, um die standortübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit zu erleichtern? Und nun, auf in euer gemeinsames Projekt! Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen Verbundarbeit im Fokus – Koordination, Qualitätssicherung und Zusammenarbeit im Projekt QUADIS Organisiert mit Infinity Maps in pädagogischen Seminaren Hochschulübergreifende Kooperation mit Transparenz und agilen Tools Kategorien How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Was macht eine gute Zusammenarbeit aus? Eine gute Zusammenarbeit ist essenziell für ein gutes Arbeitsergebnis. Am wichtigsten ist hierbei zunächst die Kommunikation innerhalb eurer Gruppe, denn sie ist der Schlüssel zum Erfolg. Ihr müsst alle Gruppenmitglieder erst einmal kennenlernen und eure individuellen Stärken und Schwächen erkunden. Dadurch schafft ihr die Basis für eine gute Zusammenarbeit und Vertrauen. Bei der Kommunikation ist es vor allem wichtig, geeignete Kommunikationskanäle zu finden, von denen wir euch ein paar vorstellen werden. Sie helfen euch dabei, immer auf dem neuesten Stand eurer Arbeitsergebnisse zu sein, aber auch die Fortschritte eurer Gruppenmitglieder im Auge zu behalten. Dies ist nützlich, damit ihr euren Zeitplan einhalten könnt und eine strukturierte und übersichtliche Arbeitsweise findet. Über die gewählten Kommunikationskanäle kann auch die Planung und der Austausch zu eurer Arbeit erfolgen. Während eurer Zusammenarbeit ist es besonders wichtig, auf einen respektvollen Umgang zu achten und so eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Sie ermöglicht es allen Gruppenmitgliedern, ihre Gedanken, Anliegen und auch eventuelle Bedenken zu äußern, um so zum bestmöglichen Ergebnis zu gelangen. Wenn ihr die Regeln und Werkzeuge eurer Kommunikation geklärt habt, ist der nächste wichtige Schritt die Aufgabenverteilung. Diese sollte in erster Linie gerecht sein, sich aber auch an den Stärken und Schwächen der einzelnen Mitglieder orientieren. Jede*r einzelne ist dann dafür verantwortlich, dass sein oder ihr Teil der Aufgabe gewissenhaft und innerhalb zeitlicher Begrenzungen erfüllt wird. Jede*r muss sich also der eigenen Verantwortlichkeit bewusst sein. Und um dieses Bewusstsein zu erreichen, gibt es ebenfalls Tools, die euch dabei helfen können. Diese können euer Gruppenprojekt gliedern und euch helfen, euch eine Übersicht zu verschaffen, um dann im späteren Verlauf richtig in die Thematik einsteigen zu können. Wie ihr seht, gibt es für jegliche Bereiche der Gruppenarbeit Tools, die euch eure Zusammenarbeit erleichtern, ob am Anfang in der Kommunikation oder auch im späteren Verlauf. Und hierzu möchten wir euch im Folgenden Tools nahelegen, die sich als sehr hilfreich für unser eigenes gemeinsames Projekt erwiesen haben. Welche Tools könnt Ihr nutzen, um die standortübergreifende Kommunikation
Organisiert mit Infinity Maps in pädagogischen Seminaren
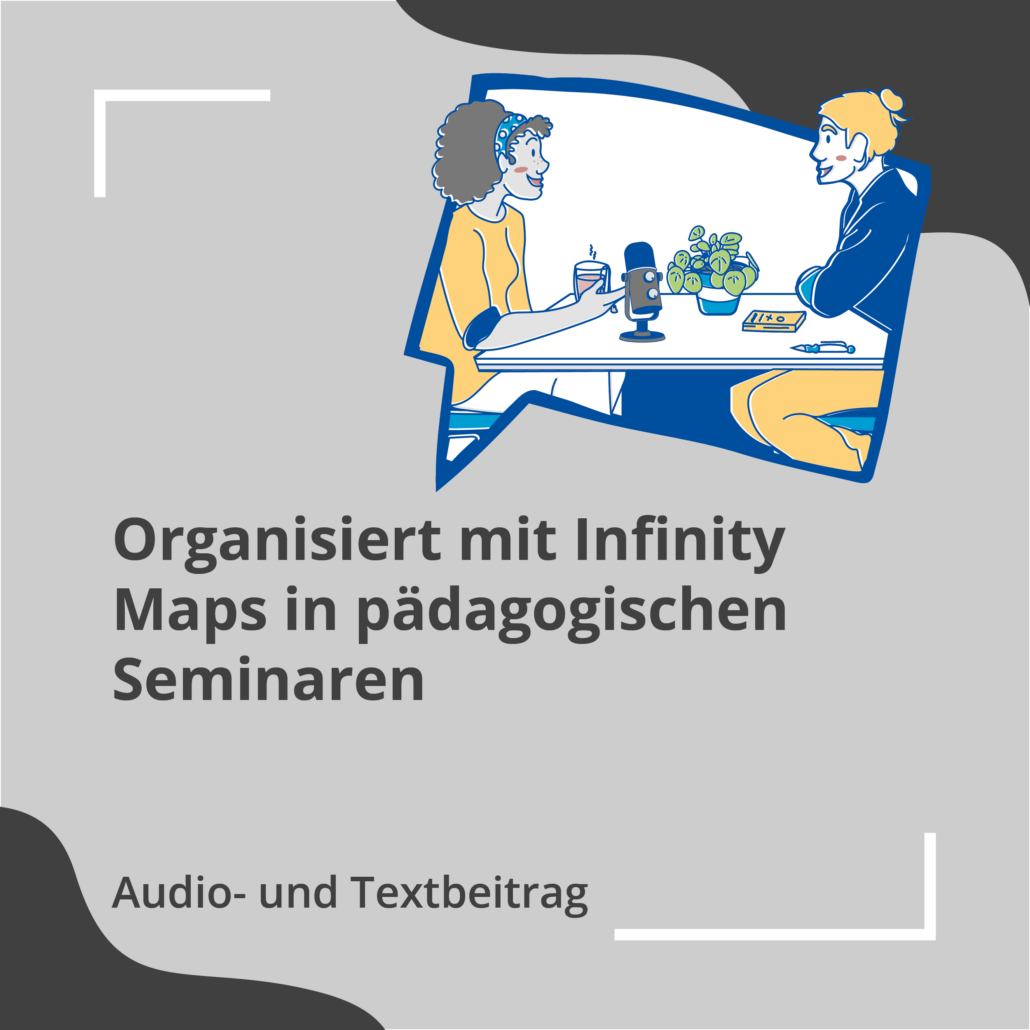
Organisiert mit Infinity Maps in pädagogischen Seminaren Interview mit Theresa Niemann von der Technischen Universität Braunschweig Theresa Niemann ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaft in der Abteilung Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik der TU Braunschweig tätig. Sie forscht unter anderem in den Bereichen Peer-Beziehungen im Zusammenhang von Digitalisierung sowie in der Lehrkräfteaus- und Fortbildung. Im Wintersemester 23/24 hat sie das durch das Projekt Co3Learn bereitgestellte Visualisierungstool „Infinity Maps“ in ihrer Lehre eingesetzt und getestet. Im Interview berichtet sie von ihren Erfahrungen mit dem Tool und teilt ihre Learnings. Anna: Theresa, Du hast dich im Wintersemester 23/24 in deinen Lehrveranstaltungen auch mit dem Einsatz von Tools für kooperative und kollaborative Arbeitsphasen beschäftigt. Kannst du uns zu Beginn kurz erklären, was für Lehrveranstaltungen du im Wintersemester 23/24 an der TU Braunschweig durchgeführt hast und in welchem Format diese Lehrveranstaltungen stattgefunden haben? Theresa: Ich hatte zwei Seminare im Master Lehramt, eins davon als Basismodul und einmal ein fortgeschritteneres Modul und dabei alle Richtungen, also Grundschule, Haupt-, Realschule und gymnasiales Lehramt. Ich mache es eigentlich in all meinen Seminaren so, dass ich in einem Wechselmodus zwischen Präsenz und digitalem Lernen arbeite. Also sehe ich die Studierenden alle zwei Wochen. Wir machen dann in Präsenz Präsentationen, aber auch Aufgaben und Gruppenarbeiten. In allen anderen Sitzungen haben die Studierenden eine Courseware zu bearbeiten, die unterschiedliche Arbeitsaufträge beinhaltet. Diese werden dann zum Teil auch im Seminar nachgesprochen, sind zum Teil aber auch ein bisschen losgelöst davon. Das Modul nur für gymnasiales Lehramt hat dabei noch die Besonderheit, dass die Studierenden selbständig ein Forschungsprojekt planen müssen. Dafür haben sie dann gegen Ende des Semesters viele Freilernphasen und auch Aufgaben für die vorlesungsfreie Zeit, weil dann kurz vor dem Sommersemester noch eine Blockphase von vier Tagen stattfindet. In dieser werten wir dann das Forschungsprojekt gemeinsam aus. Das setzt voraus, dass eine gewisse Vorarbeit durch die Studierenden eigenständig gemacht wird, die wir dann gemeinsam beenden in dieser Blockphase. Anna: Was würdest du sagen, welche Rolle Kooperation und Kollaboration in diesen Lehrveranstaltungen auch für dich spielen? Theresa: Ich würde erst mal sagen, dass mir Austausch grundsätzlich sehr wichtig ist. Corona hat mir auch noch einmal gezeigt, dass man einfach am meisten lernt, wenn man sich austauscht und gemeinsam Inhalte bespricht und an Aufgaben arbeitet. Und da versuche ich auch in meinen Seminarsitzungen immer Slots einzuplanen, in denen Partner*innenarbeit oder Gruppenarbeiten stattfinden.Also meist ist es so, dass ich am Anfang eine PowerPoint zeige und dann entweder Arbeitsphasen zwischengeschaltet oder aber ans Ende geschaltet sind. In diesen Arbeitsphasen geht es dann viel darum, dass kooperiert wird, dass sich ausgetauscht wird über Inhalte. Ich finde es aber auch grundsätzlich wichtig, den Kontakt zwischen Studierenden herzustellen, weil Studium bedeutet auch erstmalig nach der Schule mit anderen Personen in Kontakt zu kommen. Da sehe ich mich schon in der Pflicht als Dozentin, Raum dafür zu schaffen, damit auch die Zusammenarbeit in digitalen Lerneinheiten gut stattfinden und in Zeiten, wie der „Corona-Pandemie“ aufrechterhalten werden kann. Dafür braucht man auch im digitalen Setting die Möglichkeit, Arbeitsgruppen einzuteilen und Studierende kooperieren und kollaborieren zu lassen. Ich stelle diese Arbeitsform aber immer als freiwilliges Angebot zur Verfügung, weil es auch Personen gibt, die einfach grundsätzlich lieber allein arbeiten und das respektiere ich auch. Kapitel Wichtige Elemente in kooperativen und kollaborativen Arbeits-prozessen aus Lehrenden-perspektive Arbeit mit dem Tool Infinity Maps in der Lehrveranstaltung Arbeitsschritte im Tool Infinity Maps Wünsche an die eigene Hochschule und zugehörige Einrichtungen Autorinnenprofil Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen 12# Wissensnugget – Winterpause 11# Wissensnugget – Chat AI als Lernbuddy Instagram als projektbegleitende Kommunikationsplattform für studentische Beteiligung Kategorien Aktuelle Veranstaltungen Allgemein How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Aber ich finde es wichtig, den Studierenden zumindest das Angebot bereitzustellen, sich austauschen und zusammenarbeiten zu können. Insbesondere in meinem Veranstaltungsmodul mit dem Forschungsprojekt ist es unerlässlich, dass die Studierenden kooperieren und auch kollaborieren, weil sie das Forschungsprojekt gemeinsam gestalten. In Einzelarbeit wäre es viel zu viel Arbeit und das versuche ich auch am Anfang des Semesters sehr deutlich zu machen. Man kann es nicht alleine schaffen, weil dazu das Arbeitspaket viel zu groß ist. Es handelt sich um eine Studie, die die Studierenden planen, die sie durchführen, die sie auswerten und das benötigt ein hohes Maß an Eigenorganisation und dann aber auch an Gruppenorganisation und Kollaboration. Andernfalls ist am Ende dann die Prüfungsleistung nicht so gut oder der Outcome von dem Forschungsprojekt nicht so gut. 0:00 / 0:00 Interview Auszug 1 Anna: Danke dir für deine Einschätzung dazu. Du hast eines der digitalen Tools, die das Projekt Co3Learn zur Förderung kooperativer und kollaborative Prozesse im Lehren und Lernen testet, in deinen Lehrveranstaltungen eingesetzt. Kannst du dazu bitte nochmal kurz berichten, in welcher Lehrveranstaltung du das Visualisierungstool Infinity Maps eingesetzt hast und in welchem Umfang du es in deine Lehre integriert hast? Hast du es zum Beispiel nur punktuell für bestimmte Situationen genutzt oder vollständig semesterbegleitend? Theresa: Ich habe es in den beiden Modulen unterschiedlich eingesetzt. Im Basismodul, in dem wir sehr viele Themen gebündelt behandeln müssen, habe ich es für zwei Sitzungen punktuell verwendet. Einmal mussten die Studierenden gemeinsam Informationen sammeln. Das Tool haben wir als eine Art Pinnwand, die dann für alle einsehbar und abrufbar bleiben sollte, genutzt. Zum Beispiel konnten die Studierenden diese dann als Vorbereitung auf die Klausur, also als eine Art digitalen Lernzettel, verwenden.Im fortgeschrittenen Modul habe ich Infinity Maps vor allem gegen Ende des Semesters und über die vorlesungsfreie Zeit hinweg genutzt, um die Gruppen zu strukturieren oder sich strukturieren zu lassen. Das heißt, ich habe zum Beispiel Deadlines eingepflegt, Studierende konnten mir über das Tool aber auch Fragen stellen und die Gruppen haben untereinander diese Fragen und die Antworten meinerseits einsehen können. Ich konnte dann auch über die Plattform Rückmeldung geben, die auch alle sehen konnten. So war — oder sollte mir erspart bleiben — dass ich eine Flut von E-Mails bekomme, die alle ähnliche Fragen beinhalten, weil die Studierenden so sehen konnten, was für Fragen gestellt
Botanische Exkursionen: Audiounterstützte Selbstlern-Exkursionen fördern Integration und Flexibilität
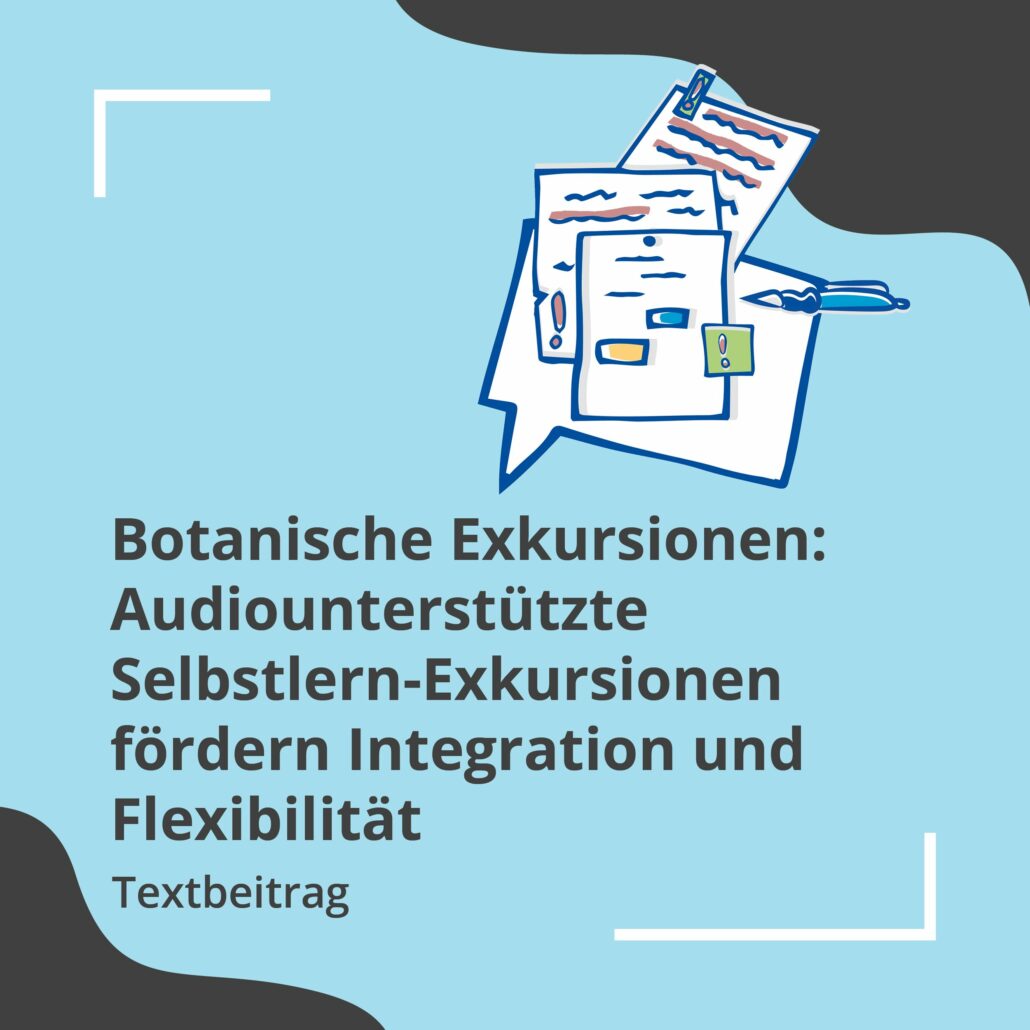
Botanische Exkursionen: Audiounterstützte Selbstlern-Exkursionen fördern Integration und Flexibilität von Florian Goedecke und Friedemann von Lampe Neue Unterrichtsansätze während der Pandemie Während der Pandemie mussten Dozierende ihre Lehrmethoden anpassen. Einige der neuen Formate sind wieder verschwunden, während andere inzwischen zu einem zentralen Bestandteil des Unterrichts geworden sind. Exkursionen in großen Gruppen waren untersagt, sodass Lehrende für Botanik und Vegetationskunde neue Ansätze entwickelten. Dazu gehörten a) Präsentationsfolien mit oder ohne Audiokommentar; b) vorbereitete Wege im Umfeld der Universität mit botanischen Namensschildern; und c) die Verwendung von Apps (z. B. Actionbound und GöTours) mit Bildern und Aufgaben, welche an reale Koordinaten gebunden sind.Ein neues Format zum individuellen Kennenlernen von Pflanzenarten im Kontext verschiedener Umweltaspekte vor Ort war an Audiodateien gebunden. Dieses Format hat sich im Hinblick auf Aktivierung, Integration und Flexibilität als vorteilhaft erwiesen und ist auch nach der Pandemie anwendbar. In botanischen Exkursionen werden Pflanzenarten in Beziehung zu ihrer Umwelt vorgestellt. Wie werden botanische Exkursionen durchgeführt? Bei botanischen Exkursionen stellen Dozierende in der Regel Pflanzenarten vor, sowie ihre Erkennungsmerkmale, ihre ökologischen Ansprüche und Beziehungen zu menschlichen Aktivitäten. Aber es geht um mehr als nur um die Vermittlung von Wissen. Enthusiasmus der Dozierenden, kleine Anekdoten, die Beteiligung der Studierenden und das Eingehen auf spezifische Fragen und Interessen sind entscheidend. In der Regel schreiben die Studierenden Feldprotokolle mit Artenlisten und Informationen über den Standort, und eine Begehung vor Ort ist dabei von zentraler Bedeutung. Bei größeren Gruppen kann es jedoch vorkommen, dass Studierende den Anschluss verlieren oder Erklärungen nicht folgen können. Schmale Wege und schwieriges Gelände können insbesondere für Menschen mit Beeinträchtigungen Schwierigkeiten bereiten, und die Integration internationaler Studierender hängt von den sprachlichen Fähigkeiten der Dozierenden ab. Kapitel Neue Unterrichtsansätze während der Pandemie Wie werden botanische Exkursionen durchgeführt? Audioexkursionen als neues Format Was soll für die Zukunft erhalten bleiben? Stimmen von Studierenden Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen 12# Wissensnugget – Winterpause 11# Wissensnugget – Chat AI als Lernbuddy Instagram als projektbegleitende Kommunikationsplattform für studentische Beteiligung Kategorien Aktuelle Veranstaltungen Allgemein How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Audioexkursionen als neues Format Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat unser Fachbereich ein neues Lehrformat für Selbstlern-Exkursionen entwickelt. Die Studierenden erhielten GPS-Dateien, einen PDF-Guide mit Bildern und Informationen zu Pflanzenarten sowie eine Reihe von Audiodateien im mp3-Format. Um eine hohe Qualität der Audiodateien zu gewährleisten, wurden die Aufnahmen mit einem professionellen Mikrofon gemacht und anschließend nachbearbeitet. Sie bieten umfassende Informationen, z. B. über Geologie, Böden, Auswirkungen des Klimawandels, Pflanzenkrankheiten und Bewirtschaftungsmethoden. Um die Teilnehmenden aktiv einzubinden, wurden spezifische Beobachtungsaufgaben erarbeitet und integriert. Der erste Lernpfad wurde im Jahr 2020 am Westerberg im Göttinger Stadtwald (Demant & Goedecke) entwickelt. Eine weitere Exkursion in den Solling (Bergmeier, Utermann & Goedecke) beinhaltete Aufnahmen aus dem Feld sowie Beiträge lokaler Experten. Im Jahr 2021 wurde eine zweisprachige Audioexkursion zum Teichgebiet um Walkenried eingerichtet (von Lampe & Goedecke). Der folgende Ausschnitt gibt einen Einblick in die Audioexkursion und beschreibt die Teichkaskade des Exkursionsgebietes. Sie können die Audiodatei hier zusammen mit den Begleitmaterialen herunterladen, um eine genauere Vorstellung von der didaktischen Gestaltung der Audioexkursion zu erhalten. Die Aufnahme der Audiobeiträge geschieht vor Ort mit Blick auf das Exkursionsgebiet, um Studierenden die Orientierung bei der selbständigen Exkursion zu erleichtern. 0:00 / 0:00 Beispiel einer Audioexkursion Die Beispielaufnahme der Station 2 beschreibt die Teichkaskade des Exkusionsgebietes. Was soll für die Zukunft erhalten bleiben? Einige wichtige Aspekte sind auch zukünftig vorteilhaft. Insbesondere große, heterogene Gruppen können von dem asynchronen Selbstlern-Format profitieren. Es ermöglicht ein individuelles Lerntempo und vertiefte Beobachtungen und kommt so unterschiedlichen Lernstilen und -geschwindigkeiten entgegen (siehe Feedback der Studierenden unten). Das Format bietet außerdem Flexibilität, da es in reguläre Lehrveranstaltungen integriert oder von Studierenden genutzt werden kann, die nicht an den angebotenen Exkursionen teilnehmen können. Die Aktivierung der Studierenden durch vorbereitete Aufgaben während der Audioexkursionen ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Lernerfahrung verbessert und Lücken in der Interaktion füllt. Dieses Format hat sich in schwierigen Zeiten bewährt. Mit der richtigen Vorbereitung kann es auch über die Pandemie hinaus als flexibles und integratives Unterrichtselement eingesetzt werden. Stimmen von Studierenden „Ich bin überrascht gewesen über die gute Qualität! Davon können sich einige Möchtegern Podcaster:innen eine Scheibe abschneiden! Ich hatte immer das Gefühl ihr steht direkt neben mir.“ „Man kann sie sich ja öfter anhören, was doch ein deutlicher Vorteil gegenüber eine normalen Exkursion ist!“ „Ich finde die Idee sehr gut und innovativ und einen echt guten Ersatz für Präsenz-Exkursionen! Ich würde behaupten, dass mein Lernerfolg auch höher war als in Präsenz, zumindest was die Bestimmung angeht“ „Die Arbeitsaufträge fand ich spannend, vor allem die Kartierung.“ „In Zeiten der Online Lehre war das wirklich sehr erfrischend. :)“
Begleitung von studentischen Gruppen in der Psychologie
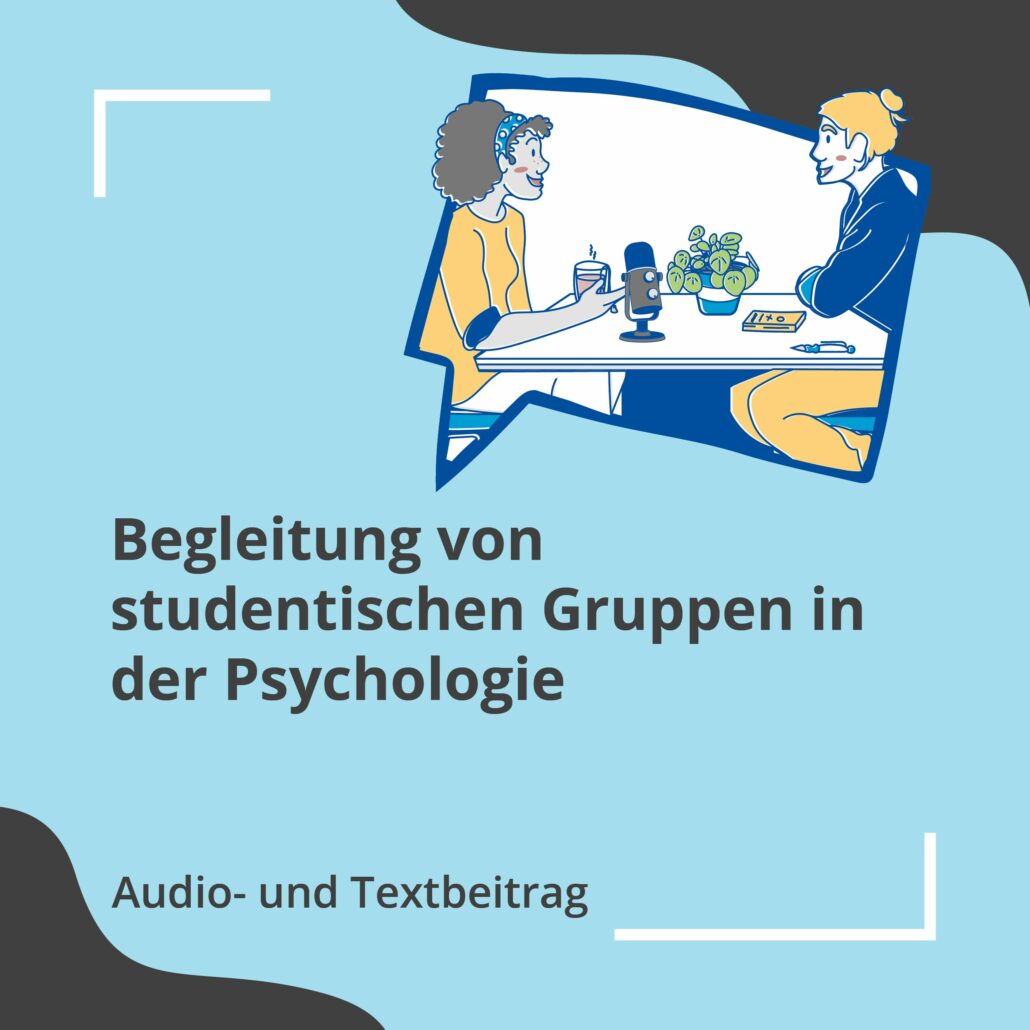
Begleitung von studentischen Gruppen in der Psychologie Interview mit Dr. Eva-Maria Schulte-Seitz von der Technischen Universität Braunschweig Ich freue mich, heute mit Dr. Eva-Maria Schulte-Seitz sprechen zu können. Sie arbeitet an der Technischen Universität Braunschweig und ist Expertin in den Themen gesundes Arbeiten, gesundheitsförderliche Führung, Coaching und Training. Seit 2009 arbeitet sie am Lehrstuhl Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie und ist hier tätig als Dozentin, Karrierecoach und Senior-Teamleitung. Sie leitet verschiedene Forschungs- und Praxisprojekte – darunter auch das heute zu besprechende Projekt PERFORM: PERsonalentwicklung in Zeiten der digitalen TransFORMation: Reflexive Lernprozesse mittels eines studienfachübergreifenden Ansatzes fördern. Dieses wird durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre (Freiraum 2022) gefördert. Hier entwickelt Eva-Maria mit ihren Kolleginnen ein neues Konzept für Psychologie-Studierende, in dem sie gemeinsam über zwei Semester zusammenarbeiten und sich als Trainer*innen ausprobieren können. Im Interview geht Eva-Maria besonders auf die studentische Zusammenarbeit ein. Sophie: Kannst du bitte erzählen, in welchem Kontext ihr die studentische Zusammenarbeit in PERFORM umsetzt? Eva-Maria: Ziel von dem Projekt ist, dass wir ein neues Modul entwickeln für Studierende der Psychologie im Master, die auf ihre Rolle als Trainer*in oder allgemeiner als Lernbegleiter*in vorbereitet werden. Wir versuchen möglichst viel praxisnahe Lernerfahrung in die Veranstaltung zu integrieren. Dabei nutzen wir unterschiedliche kooperative Formate der Zusammenarbeit, auch mit einem forschenden Lernprojekt. Gleichzeitig wird das ganze verzahnt mit den handlungsbezogenen Kompetenztrainings, die wir hier an der TU Braunschweig als Lehrstuhl verantworten und an denen ca. 250 Studierende aus allen Fachrichtungen pro Semester teilnehmen können. Themenbereiche sind hier u.a. Bewerbung und Assessment Center, Design Thinking, Personalführung oder Kommunikation und Motivation. Dabei haben unsere Psychologie Studierenden die Chance, in die Trainer*in Rolle zu schlüpfen und praktische Erfahrung zu sammeln. Gleichzeitig werden die Trainings durch unser Projekt auch für die Studierenden aus den anderen Fachbereichen weiterentwickelt und neue Konzeptideen erprobt. Hier arbeiten alle Studierenden und das Projektteam zusammen. Sophie: Ist die Arbeit der Studierenden untereinander dabei auch ein Projektziel oder läuft das so nebenher mit?Eva-Maria: Es ist ein Teilziel, um unsere Hauptziele zu erreichen. Das Hauptziel ist, sie auf die Rolle als Lernbegleiter*in in einer sich wandelnden Arbeitswelt vorzubereiten, und dafür auch die reflexiven Prozesse zu ermöglichen, die es meiner Meinung nach braucht, um sich auch in diese Rolle wirklich einzufinden und sie auch nicht nur auf einer theoretischen Ebene anzunehmen oder zu sehen. Und für diese Reflexion ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, wenn man eben nicht nur mit sich alleine unterwegs ist oder in der Großgruppe dann unterwegs ist im Seminarkontext, sondern eben sich auch noch mal in einen sehr geschützten Rahmen in einer Peer-Dyade oder Triade einfach austauschen kann und über ein Jahr sehr eng zusammenarbeitet. Damit tragen wir zur Zielerreichung bei, dass sie sich auf der Peerebene gut austauschen, sich gegenseitig dann auch befruchten und gute Fortschritte erzielen. 0:00 / 0:00 Interview Auszug 1 Kapitel Strukturen & Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit Vorteile und Herausforderungen dieses Konzept der Lehre und des Studierens Diese Formate langfristig in die Lehre etablieren Wunsch an das System Hochschule für didaktische Unterstützung Links zum Weiterlesen Autorinneninformation Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen 12# Wissensnugget – Winterpause 11# Wissensnugget – Chat AI als Lernbuddy Instagram als projektbegleitende Kommunikationsplattform für studentische Beteiligung Kategorien Aktuelle Veranstaltungen Allgemein How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Sophie: Es sind sehr viele Aufgaben und Methoden und Begleitformate, die ihr da anbietet. Wie ist das denn unter den Studierenden, also wie arbeiten die miteinander? Gebt ihr auch was vor, wie sie zusammenarbeiten sollen?Eva-Maria: Nein, wie sie es genau machen steht ihnen frei, nur inhaltlich müssen sie sich einig sein. Wir versuchen möglichst viel Rahmen zu schaffen. Das heißt, es gibt beispielsweise ein Advanced Organizer, sodass Sie wissen, wann sind welche Deadlines, wann müssen sie als Dyade was gemacht haben. Aber wie sie sich dann untereinander organisieren, ob sie sich in Präsenz treffen, ob sie sich online treffen, wie Sie das genau ausgestalten steht ihnen frei. Sophie: Ja, du hast schon den Advanced Organizer und das Feedback angesprochen. Wie bildet ihr das ab? Habt ihr da bestimmte Tools oder arbeitet ihr über Stud.IP? Eva-Maria: Wir arbeiten primär über das Stud.IP, das heißt dort fließt alles zusammen, sowohl die E-Learning Einheiten als auch die Unterlagen (Inhalt und Reflexion), die sie für ihre Kleingruppen oder die Dyaden dann entsprechend brauchen. Auch der Advanced Organizer ist da dann noch mal abgebildet, das heißt, das ist so die Hauptplattform. Zusätzlich kommen dann per E-Mail noch bestimmte Sachen und vor Ort in Präsenz dazu. Sophie: Nutzt ihr auch Tools zur Erstellung von Wortwolken oder kleinen Umfragen?Eva-Maria: Dadurch, dass die Gruppe in diesem ersten Durchgang relativ klein ist, also es sind nur 13 Teilnehmende, arbeiten wir vor Ort weniger damit. Was wir aber machen, und dazu haben wir einen komplett eigenen Termin, ist die möglichen Tools vorzustellen. Das heißt, dass die Studierenden eben schon eher aus der Trainer*in Perspektive lernen sollen. “Wie kann ich denn auch solche Tools einsetzen und was kann ich da irgendwie auch nutzen?” und da versuchen wir mit dem Handout, aber auch mit dem E-Learning einen relativ breiten Überblick zu geben, verweisen da auch unter anderem auf eure Übersichtsseiten aus dem Projekthaus, dass sie da nochmal reingucken können – auch hier gehen wir sehr studierendenzentriert vor, so dass sie selbst entscheiden können, welches Tool sie ausprobieren. Vor Ort stellen sie dann noch mal vor, was sie spannend fanden und wie ihr Testerlebnis war und diskutieren dies dann – auch mit Blick auf unterschiedliche Zielgruppen und Gruppengrößen. Sophie: Was sind das für Formate der Selbstlerneinheiten und welche Aufgaben bekommen sie dazu?Eva-Maria: Im Sommersemester haben wir mehrere Halbtags-Workshops mit inhaltlichen Schwerpunkten. In Vorbereitung zu dem Workshop gibt es dann immer eine E-Learning Einheit, die dann sehr unterschiedlich gestaltet ist. Wir haben drei E-Learning Einheiten, die jetzt recht klassisch mit Screencasts arbeiten, zu denen wir vertiefende Quizfragen stellen. Wir haben auch Einheiten, bei denen die Studierenden online gemeinsam Aufgaben auf einem Whiteboard bearbeiten oder Dinge sammeln sollen. Wir haben auch die „digitalen Tools E-Learning Einheit“, in der sie von uns ein umfangreiches Handout bekommen, mit Anregungen für mögliche Tools in unterschiedlichen Szenarien. Das sind einfach gute Seiten, wo man sich noch weiter informieren kann. Sie lösen sich dann von Stud.IP und recherchieren und probieren Tools aus, die sie selbst spannend finden. Sophie: Manche Sachen, die Quizfragen stelle ich mir vor, beantworten sie jede individuell und dann gibt es aber auch Aufgaben, die sie gemeinsam bearbeiten sollen – habe ich das richtig verstanden?Eva-Maria: Genau insbesondere dann in der Vor- und Nachbereitung für die Projekte und für die Trainings, die sie durchführen. Also auch da bekommen sie die Unterlagen über Stud.IP zur Verfügung gestellt und sollen sich dann als Dyade oder Triade mit den Leitfragen auseinandersetzen und die Sachen vorbereiten. Sophie: Wie habt ihr die Zweier- und Dreiergruppen in PERFORM eingeteilt?Eva-Maria: Ich bin da auch immer sehr

