Mehr Selbstvertrauen durch digitale Tools? Vevox als Chance für fremdsprachlichen Literaturunterricht
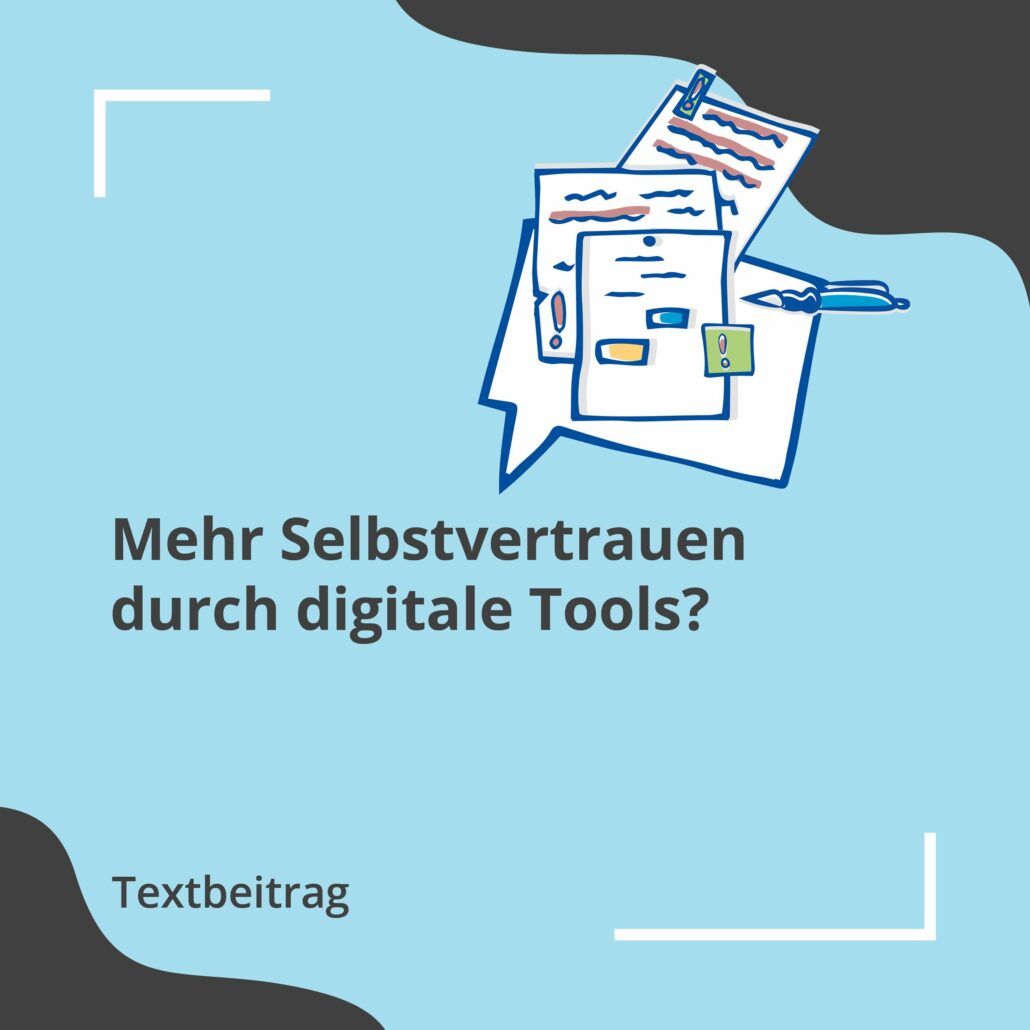
Mehr Selbstvertrauen durch digitale Tools? Vevox als Chance für fremdsprachlichen Literaturunterricht von Lisa Kemper Als ich mit Ende 20 zum ersten Mal als Dozentin ein Seminar in der französischen Literaturwissenschaft leitete, fiel mir – trotz geringen Altersunterschiedes gegenüber den Bachelorstudent*innen – sofort eine Diskrepanz zwischen ihnen und mir auf. Während ich mein Studium hauptsächlich handschriftlich und mit Kopien oder Printausgaben bestritten habe, arbeiteten sie fast ausschließlich mit Tablets oder Laptops. In der zweiten Sitzung einer meiner Kurse brachte ich Kopien mit, um meinen Student*innen einen Gefallen zu tun. Meine Mühe wurde mit freundlichem Lächeln quittiert, aber die Arbeitsblätter bekam ich unbeschrieben zurück. Die Kursteilnehmer*innen hatten sie im Handumdrehen mit ihren Tablets eingescannt und somit digital für sich nutzbar gemacht. Spätestens in diesem Moment wurde mir klar, dass ich mich mehr mit dem Thema der Digitalisierung beschäftigen muss. Insbesondere für die Geisteswissenschaften erscheint mir dies wichtig, damit sie gegenüber anderen Disziplinen interessant und anschlussfähig bleiben.Deswegen begann ich, meine Unterrichtsmaterialien direkt in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Generell versuchte ich, häufiger Internetquellen zu verwenden. Ich konzentrierte mich z.B. stärker auf Online-Wörterbücher und digitale Ausgaben von literarischen Werken und Fachbüchern. Schnell merkte ich jedoch, dass dies noch nicht ausreicht, um den digitalen Anforderungen der Lernenden gerecht zu werden. Passenderweise kam ich genau zu diesem Zeitpunkt mit dem Team von Co3learn in Göttingen in Kontakt. Man machte mich mit einigen Tools vertraut und nahm mir damit schnell meine Scheu vor digitaler Lehre und der dazugehörigen Technik. So entdeckte ich vor allem das Audience-Response-Tool Vevox für mich. Ich verwende es seitdem für ganz unterschiedliche Zwecke. Um ein neues Thema zu beginnen, benutze ich etwa die Funktion „Word-Cloud“ für ein erstes Brainstorming. Die Word-Cloud ermöglicht den Student*innen, bereits vorhandenes Wissen über eine literarische Gattung wieder zu aktivieren. Auch kann ich als Dozentin auf diese Weise sehen, an welche Erfahrungen in kommenden Sitzungen anzuknüpfen ist. Das Tool ist niedrigschwellig und lässt sich größtenteils intuitiv nutzen. Sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung im Seminar ist es nicht allzu zeitintensiv. Durch das Einscannen des QR-Codes oder das Eingeben der ID, erhalten die Teilnehmer*innen direkt und unkompliziert über ihre Handys oder Tablets Zugang zur Umfrage. Sie können dann mehrfach und vor allem anonym ihre Assoziationen zu einem Begriff eingeben. Die Word-Cloud übernimmt also gewissermaßen die Funktion der klassischen Mindmap. Der Vorteil besteht hier aber darin, dass man als Dozent*in nicht oldschool-mäßig an der Tafel schreibt, wischt und wieder alles umändert. Die Word-Cloud ordnet die Begriffe eigenständig und je öfter ein Begriff genannt wird, desto größer und zentraler ist er abgebildet. Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen 12# Wissensnugget – Winterpause 11# Wissensnugget – Chat AI als Lernbuddy Instagram als projektbegleitende Kommunikationsplattform für studentische Beteiligung Kategorien Aktuelle Veranstaltungen Allgemein How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Die Student*innen bekommen dadurch sofort ein Feedback, ohne sich möglicher Kritik der Kommiliton*innen direkt ausgesetzt zu sehen. Auch können sie von dem Dokument zur Ergebnissicherung einen Screenshot anfertigen und müssen nicht etwa die ganze Zeit mitschreiben. Ich habe das Gefühl, mit solch einem Tool bedeutend mehr Student*innen erreichen zu können. Wenn man ein Brainstorming im offenen Unterrichtsgespräch durchführt, sind es doch immer dieselben wenigen Teilnehmer*innen, die den Mut aufbringen, um offen am Dialog teilzunehmen. Meine Schützlinge teilten mir mit, dass sie sich vor allem in größeren und noch unbekannten Gruppen mehr Einsatz solcher Tools wünschen würden. Auch in stark kompetitiven Settings könnte der Einsatz von digitalen und anonymisierten Mitteln hilfreich sein. Ich denke außerdem, dass z.B. Vevox gerade im Bereich des fremdsprachlichen Unterrichts, oder auch im Fremdsprachenerwerb allgemein, großartige Chancen zu bieten hat. Durch Konkurrenzdruck oder eine als zu extrem erlebte Heterogenität in der Lerngruppe bestehen bereits genug Hemmungen. Diverse Sprech-Ängste verstärken sich selbstverständlich, wenn die Student*innen auch noch in einer Fremdsprache kommunizieren sollen. Die Angst, bei einer Wortmeldung nicht nur einen inhaltlichen, sondern auch noch einen sprachlichen ‚Fehler‘ zu begehen, führt meistens zu eher geringer Beteiligung im Kurs. Digitale Tools hingegen ermöglichen es den schüchterneren Teilnehmer*innen, einen Begriff erst einmal ‚unbeobachtet‘ auszuprobieren und ein anonymes Feedback zu erhalten. Ich persönlich hatte nach der beschriebenen Verwendung von Vevox auch das Gefühl, dass darauffolgend mehr Student*innen am offenen Unterrichtsgespräch teilnahmen. Anscheinend hatten sie durch das Tool für sich selbst mehr Sicherheit und Mut gewonnen. Am Ende des Semesters habe ich das Umfragetool dann auch noch für ein abschließendes Feedback verwendet. Hierbei habe ich mich verschiedener Fragemodi bedient. Zunächst gab es mehrere Multiple-Choice-Fragen, bei denen etwa beurteilt werden sollte, als wie angemessen das Niveau und der Arbeitsaufwand der Veranstaltung erlebt wurden. In diesem Fall konnten die Student*innen jeweils eine von drei oder vier vorgegebenen Antworten aussuchen. Vevox zeigt dann direkt an, zu wie viel Prozent welche Möglichkeit ausgewählt wurde. Zum Schluss stellte ich dann auch offene Fragen. Beispielsweise wollte ich gerne wissen, als wie nützlich mein Feedback allgemein und zu den drei schriftlichen Prüfungsvorleistungen empfunden wurde. Diese Umfrage führte teilweise zu eher vagen Aussagen. In dieser konkreten Situation war das nicht schlimm, weil die Frage zu einem recht ausführlichen direkten Gespräch über die Feedback-Kultur an Universitäten führte und mir interessante Einblicke lieferte. Für mich ergab sich dennoch der Lerneffekt, dass auch offene Fragen konkreter formuliert sein müssen. Womöglich hätte ich nach einem ganz bestimmten Aspekt meiner Rückmeldungen fragen müssen. Man lernt nie aus! Abschließend kann ich sagen, dass Vevox meine Lehre sehr bereichert hat. Das Tool stellt eine nette Abwechslung für die anscheinend technisch begeisterte Studentenschaft dar. Außerdem wirkt es durch seine Anonymität sehr integrativ. Was ich für mich allgemein auch noch festgestellt habe, ist eine veränderte Rolle der Dozent*in. Diese scheint aber auch abhängig von der Art der Nutzung zu sein. Immer wenn ich Vevox als Einstieg in einen neuen Themenblock verwendet habe, kam ich mir zunächst beinahe überflüssig vor! Während meine Schützlinge fleißig Begriffe zum Thema Dramatik oder Epik sammelten und das Tool jene eigenständig verarbeitete, hatte ich plötzlich keine Aufgabe mehr. Hätte ich händisch eine Mindmap an der Tafel erstellt, dann wäre ich, ganz im Gegenteil,
Studienbeginn im Lockdown
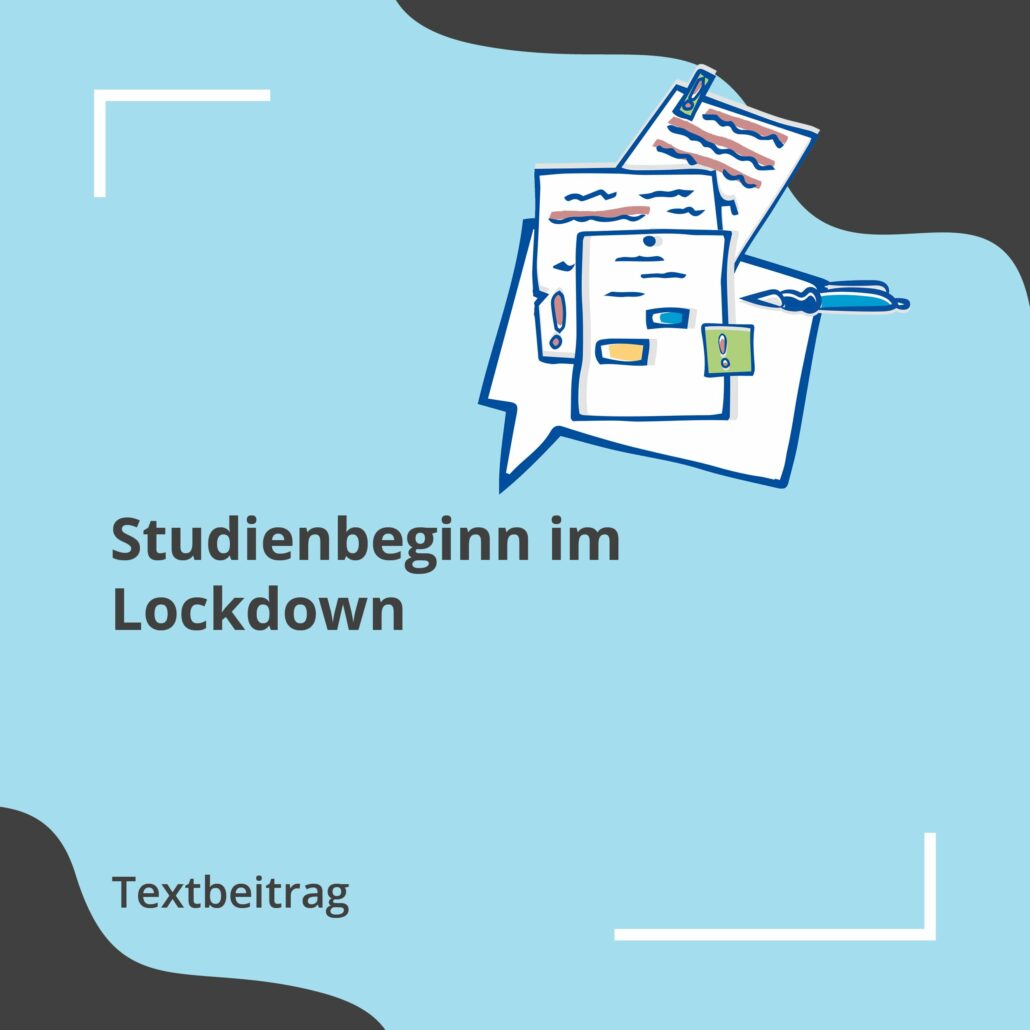
Studienbeginn im Lockdown: Was ich im Corona-Semester über digitale Zusammenarbeit gelernt habe von Kristin Siemon Für das Wintersemester 2021 schrieb ich mich für den Zwei-Fächer-Bachelor in den Fächern Germanistik und Geschlechterforschung an der Universität Göttingen ein. Ich zog nach Göttingen, machte mich mit dem Campus vertraut, entdeckte Kneipen und Restaurants. Das alles passierte innerhalb weniger Wochen. Als wäre diese Zeit nicht schon aufregend genug, wurde sie für mich noch aufregender, weil sich diese Wochen mitten in der Pandemie abspielten. Nachdem ich meine Erstsemester-Orientierungsphase und einige Informations- und Einführungsveranstaltungen erfolgreich in Präsenz hinter mich gebracht hatte, verbreitete sich Corona wieder verstärkt. Meine ersten richtigen Vorlesungen und Seminare verbrachte ich in Jogginghose vor meinem Laptop. Das war erstmal eine romantische Vorstellung: gemütlich ein paar Sätze ins Mikrofon plaudern, die Kamera wegen irgendeiner Ausrede nicht einschalten und die restliche Zeit des Seminars in irgendwelchen sozialen Netzwerken vertrödeln. Im Laufe der Zeit fehlten mir aber eindeutig die sozialen Kontakte. Das merkte ich daran, dass ich mich nicht direkt mit anderen Student*innen über diese aufregende Zeit austauschen konnte. Denn genau jetzt war doch eigentlich die Lebensphase, um eben genau diese Kontakte zu knüpfen. Das Studentenleben hatte ich mir irgendwie lebendiger vorgestellt, die Realität sah jedoch anders aus: Wir Studierenden fanden uns in einer seltsam abstrakten Welt wieder, in der unsere Kommiliton*innen in kleinen Kacheln dargestellt wurden und die Stimmen durch Lautsprecher klirrten. Was im Seminarraum spontane Diskussionen und angeregte Gespräche hätten sein können, waren jetzt zeitverzögerte Antworten und Stummschaltungen. Für die meisten Menschen stellte diese neue Art der Lehre und des Lernens eine Herausforderung oder gar Belastung dar: Wir waren anonym. Für mich war diese Situation zum Glück nur anfänglich ein Problem, denn ich gewöhnte mich schnell daran. Da ich mit meiner besten Freundin in einer Wohngemeinschaft lebte, kehrte bei mir auch nie das Gefühl der Einsamkeit ein. In dieser scheinbar distanzierten Sphäre der Digitalität wurde meiner Meinung nach aber ein erstaunlicher Wandel sichtbar. Die Studierenden lernten, sich auf anderen Ebenen zu vernetzen, sich gegenseitig zu unterstützen und ihre Zusammenarbeit in einer Weise zu gestalten, die über physische Grenzen hinwegging. Die virtuelle Welt eröffnete Räume für Zusammenarbeit, die in der analogen Welt kaum denkbar gewesen wären. Studierende aus unterschiedlichen Teilen des Landes oder sogar der Welt konnten sich ohne die Hindernisse von Entfernungen und Reisebeschränkungen miteinander austauschen. Für einige der Studierenden war die digitale Lehre vorteilhaft, weil sie teilweise noch keine Wohnung in Göttingen gefunden hatten und trotzdem problemlos an den Veranstaltungen teilnehmen konnten. Die zeitliche Flexibilität des Online-Lernens ermöglichte es außerdem, Gruppenprojekte zu gestalten, die beispielsweise verschiedene Zeitzonen berücksichtigten. Trotzdem blieben Herausforderungen natürlich nicht aus: Virtuelle Zusammenarbeit verlangt eine eindeutige und klare Kommunikation. Missverständnisse, die in einem direkten Gespräch vielleicht nicht aufgetreten wären, werden durch die Bildschirme verstärkt. Die teilweise fehlende nonverbale Kommunikation machte es schwieriger, Meinungsverschiedenheiten zu erfassen. Die digitale Lehre erforderte also Anpassung und Geduld von allen Beteiligten. Mit den richtigen Ansätzen konnte sie aber effektiv gestaltet werden. Das durfte ich zum Glück auch in einigen meiner Seminare erleben. Manche Dozent*innen gaben sich mehr Mühe, die Seminare auf besonderem Wege interaktiv zu gestalten. Meiner Meinung nach sind für eine erfolgreiche digitale Lehre vor allem folgende Punkte wichtig: eine klare Kommunikation, interaktive Plattformen, abwechslungsreiche Materialien, regelmäßige Rückmeldungen und Gruppenarbeiten. Auch wenn Gruppenarbeiten bei vielen Student*innen eher unbeliebt sind, waren sie während der Corona-Pandemie umso wichtiger. Zusammenarbeit im Studium führt zwangsläufig dazu, Menschen kennenzulernen. Und weil Möglichkeiten zum Kontakteknüpfen außerhalb der eigenen vier Wände beschränkt waren, stellten Gruppenarbeiten eine Chance dar, andere Studierende (zumindest virtuell) zu treffen. Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen Vom Insta-Scroll zum Zoom-Call Virtuelle Zusammenarbeit verstetigt etablieren Kollaborative Lehrveranstaltungen gemeinsam umsetzen Kategorien How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Die Erfahrungen mit der Zusammenarbeit im Studium variieren womöglich je nach Person, Studiengang, Projekt und den Gruppenmitgliedern. Zu den negativen Erfahrungen, die man mit Gruppenarbeit machen kann, zählt definitiv eine ungleiche Arbeitsteilung. Es kann vorkommen, dass nicht alle Gruppenmitglieder gleichermaßen etwas zur Arbeit beitragen. Das kann zu Frustration führen, wenn einige Mitglieder das Gefühl haben, dass sie mehr Verantwortung tragen als die anderen. Des Weiteren sind Kommunikationsprobleme oft ein Hindernis für eine gute Zusammenarbeit. Uneffektive Kommunikation kann zu Missverständnissen, Verwirrung und Konflikten führen. Klare Kommunikation ist entscheidend für den Erfolg der Zusammenarbeit. Außerdem treten in Gruppenarbeiten auch mal Zeitprobleme auf und die Koordination der Zeitpläne aller Gruppenmitglieder kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn sie unterschiedliche Verpflichtungen haben. Zudem kann es bei der Zusammenarbeit zwischen Studierenden zu kreativen Differenzen kommen. Schließlich kann es auch Konflikte mit sich bringen, wenn einige Mitglieder nicht die erwartete Menge an Arbeit leisten und sich auf die Anstrengungen der anderen Gruppenmitglieder verlassen. All diese Probleme und Konflikte sind mir aus der Schulzeit auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben. Seitdem ich studiere, habe ich mit der Zusammenarbeit zum Glück aber eher positive Erfahrungen gemacht. Das liegt nicht nur an mir selbst, sondern hängt auch von den anderen Gruppenmitgliedern ab. Vor allem in meinem Studiengang Geschlechterforschung kann man sich fast immer sicher sein, dass einem mit Respekt begegnet wird – und das ist eine wichtige Grundvoraussetzung für eine gute Zusammenarbeit! Ich erinnere mich immer noch gerne an ein Seminar in der Geschlechterforschung: Mit einigen anderen Student*innen sollte ich ein Referat für eine der Sitzungen vorbereiten. Wir trafen uns insgesamt dreimal digital. Ich hatte mich mittlerweile schon so gut mit den technischen Gegebenheiten vertraut gemacht, dass ich die Zoom-Meetings erstellen und die anderen dazu einladen konnte. Durch verschiedene Programme konnten wir eine ansehnliche Präsentation gestalten, die am Ende auch sehr gut bei den anderen Seminarteilnehmer*innen ankam, weil wir diese auch aktiv miteinbezogen haben. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich eine gute und engagierte Gruppe erwischt hatte, aber in den anderen Gruppen funktionierte die Zusammenarbeit wohl weniger gut. Meine Gruppenarbeit habe ich hingegen nicht nur als sehr kooperativ und interessant in Erinnerung. Vielmehr war es ein Erfahrungsaustausch. Die Personen aus meiner Gruppe erzählten von ihren Erlebnissen mit digitaler Lehre, mit ihrem Umgang mit
Literaturwissenschaftliche Gruppenarbeiten mit digitalen Whiteboards unterstützen
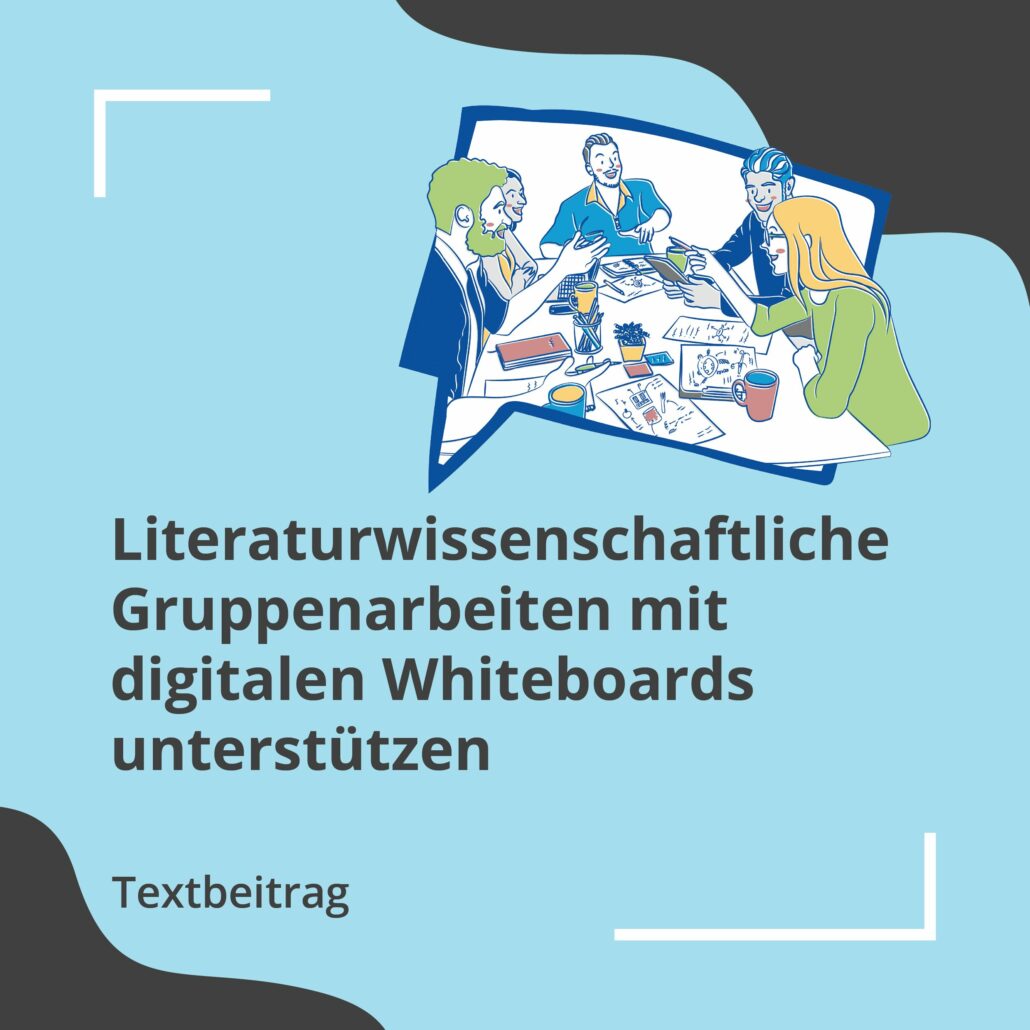
Literaturwissenschaftliche Gruppenarbeiten mit digitalen Whiteboards unterstützen von Julika Moos Obwohl es nachgewiesen ist, dass Studierende, die in Gruppen zusammenarbeiten, nachhaltiger lernen, sind Gruppenarbeiten im Studium oft eine zähe Angelegenheit: Gerade Gruppenarbeiten, die nicht über einen längeren Zeitraum (z. B. in Form einer festen Lerngruppe) hinweg existieren, sondern im Rahmen einer Sitzung als Teil der Unterrichtseinheit durchgeführt werden, können für Lehrende und Lernende gleichermaßen frustrierend sein. In der didaktischen Theorie gehören Gruppenarbeiten zwar zum Standardrepertoire des interaktiven Lernens, aber in der Praxis fallen sie im Hochschulalltag oft unter den Tisch, weil sie dann, wenn sie nicht zielführend sind, zeitraubend wirken. Ohne offensichtliche didaktische Einbindung können sich Gruppenarbeiten aus studentischer Perspektive oft wie eine Zeit-Totschlag-Strategie anfühlen, die von Dozierenden genutzt wird, um nicht die komplette Lehreinheit mit Frontalunterricht zu füllen. Aus der Lehrenden-Perspektive bleiben die typischen Herausforderungen von Gruppenarbeiten auch als Außenstehende*r nicht verborgen: Die Studierenden verwenden zu viel Zeit für Organisatorisches und Rollenklärung („Wer schreibt mit? Wer stellt vor?“) oder driften schnell in private Gesprächsthemen ab, sodass die Gruppen oft mehr Zeit benötigen und damit Zeit für das Zusammentragen der Ergebnisse verloren geht. Besonders schwierig ist es, wenn die geplante Zeit für die gemeinsame Arbeit in Gruppen hauptsächlich genutzt wird, um die Gruppenmitglieder auf den gleichen Ausgangsstandpunkt zu bringen. Denn wer Sitzungen verpasst oder die Unterlagen zu früher besprochenen Inhalten nicht parat hat, muss sich auf Kommiliton*innen in der Gruppe verlassen, die Materialien zur Verfügung stellen und Hilfe bei der Rekapitulation anbieten. Gemeinsames Wiederholen und gegenseitiges Erklären sind für den Lernprozess zwar durchaus förderlich, kann aber in diesem Fall dazu führen, dass Studierende sich unterfordert fühlen. Die Ergebnisse von jenen Gruppen, die einen Großteil der angedachten Arbeitszeit dafür gebraucht haben, sich auf den gleichen Stand zu bringen, fallen tendenziell unterkomplex aus und verhindern dann den erhofften Arbeitsfortschritt in der Lehrveranstaltung, sodass der*die Dozierende sich doch wieder in der Pflicht sieht, die erwünschten Ergebnisse selbst frontal zu präsentieren. Digitale Tools können aber dabei helfen, Gruppenarbeiten effektiver und zielgerichteter anzuleiten – wie das folgende Beispiel aus der anglistischen Literaturwissenschaft exemplarisch vorführen möchte: Eine Lösung für Herausforderungen mit Gruppenarbeiten, die im Rahmen einer Lerneinheit innerhalb einer Sitzung stattfinden, könnte die Integration eines digitalen Whiteboards sein. In Einführungsveranstaltungen der literaturwissenschaftlichen Studienfächer werden oft Modelle vermittelt, mit denen Texte untersucht werden. Ein wichtiges literaturwissenschaftliches Modell ist das Kommunikationsmodell, das darstellt, in welchem Vermittlungsverhältnis der Erzähltext, die Erzählinstanz und die Rezipierenden zueinanderstehen. Das Kommunikationsmodell kann auf Studierende anfangs befremdlich wirken, die Übertragung des abstrakten Modells auf gelesene Primärtexte funktioniert darum nicht immer reibungslos. Eine Gruppenarbeit kann jedoch dabei helfen, das Verständnis dieses Modells zu vertiefen und im Gespräch mit anderen dessen Vorteile und Herausforderungen verstehen zu lernen. Mit dem DSGVO-konformen Whiteboard-Tool Collaboard, das viele deutsche Universitäten mittlerweile an ihre Strukturen angebunden haben und kostenlos zur Verfügung stellen, lässt sich eine studentische Gruppenarbeit zum literaturwissenschaftlichen Kommunikationsmodell so anleiten, dass für Dozierende und Studierende zufriedenstellende Ergebnisse ermöglicht werden.Wird diese Gruppenarbeit mit einem digitalen Whiteboard konzipiert, kann das Tool zunächst genutzt werden, um das Modell kennenzulernen oder zu wiederholen: In der Whiteboard-Oberfläche gibt es ausreichend Platz, um die Gruppenarbeit und das Werkzeug, das dafür genutzt werden soll, parallel abzubilden, sodass die Studierenden alle wichtigen Informationen vorliegen haben und sofort gemeinsam loslegen können. Der Arbeitsauftrag in dieser Beispielübung möchte das Verständnis des Modells vertiefen und die Anwendung auf einen Roman, in diesem Fall Mary Shelleys „Frankenstein“, erproben: Die Studierenden sollen die Kommunikationsstrategie des englischen Klassikers mithilfe des Modells aufdröseln und im gemeinsamen Gespräch lernen, wo es für den Roman sinnvoll anwendbar scheint und wo es an seine Grenzen stößt. Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen Vom Insta-Scroll zum Zoom-Call Virtuelle Zusammenarbeit verstetigt etablieren Kollaborative Lehrveranstaltungen gemeinsam umsetzen Kategorien How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Dazu werden im Whiteboard vorab Sektionen für die einzelnen Gruppen angelegt, die die basale Struktur des Kommunikationsmodells nachahmen. Die Studierenden füllen dieses vereinfachte Modell mit ihren Beobachtungen zu den jeweiligen erzählenden Strukturen des Romans. Fragen oder Unklarheiten könnten unter dem Gruppenbereich in digitalen Notizzetteln notiert werden, sodass parallel eine Sammlung an Anregungen für eine anschließende Diskussion im Plenum entsteht.Durch die vorgebende Struktur im Whiteboard lassen sich organisatorische Debatten innerhalb der Gruppen vielleicht auf ein Minimum reduzieren, weil alle Gruppenmitglieder zeitgleich schreiben und gestalten können. So kann mit minimaler Vorbereitungszeit der Rahmen für eine Gruppenarbeit abgesteckt werden, bei dem auch das geplante Zeitfenster nicht überzogen werden muss. Weil das der Übung zugrundeliegende theoretische Gerüst des Kommunikationsmodells im Whiteboard mitabgelegt ist, können die Studierenden jederzeit selbstständig überprüfen, wie sich ihre eigenen Ergebnisse dazu verhalten. Außerdem arbeiten alle Gruppen parallel im selben Whiteboard, sodass für alle auch der Fortschritt der anderen sichtbar ist, was womöglich zur gesteigerten Motivation und einem Gefühl von Absicherung beiträgt – ganz egal, ob die Lehrveranstaltung in Präsenz, hybrid oder ganz digital stattfindet. Um diesen beispielhaften Arbeitsauftrag aus der Anglistik für die jeweiligen Gruppen zu individualisieren, könnten die Ergebnisse zusätzlich mit Bildern versehen werden: Durch eine illustrierende Bildersuche und die damit verbundene visuelle Annäherung an die Kategorien des Kommunikationsmodells kann der Umgang mit den Fachbegriffen zusätzlich besser erinnert werden. Unterschiedliche visuelle Ausgestaltung mit Bildern bietet für die spätere Besprechung der Gruppenarbeiten zudem einen niedrigschwelligen Einstieg für ein resümierendes Gespräch im Plenum. Falls nicht alle Gruppen an der gleichen Aufgabenstellung arbeiten sollen, könnte diese Form der literaturwissenschaftlichen Gruppenarbeit im digitalen Whiteboard auch in unterschiedliche Abschnitte unterteilt werden: Dabei bekäme jede Gruppe einen bestimmten Textabschnitt bzw. bestimmte Kapitel zugeteilt, für die das Kommunikationsmodell angewendet wird. Damit ließe sich dann darstellen, ob und wie sich die Kommunikation des Romans im Verlauf der Handlung verändert, was dann wiederum eine gute Grundlage für eine auswertende Diskussion im Plenum wäre. Der entscheidende Vorteil des digitalen Whiteboards ist dabei, dass diese mögliche Entwicklung der Erzählstrategie eines Romans quasi als chronologischer Zeitstrahl zusammen erarbeitet und anschließend auf einen Blick erfasst und nachvollzogen werden könnte. Bei einer solchen Gruppenarbeit, die ganz offensichtlich Teil einer kollaborativen Auseinandersetzung aller Studierenden mit dem Text in der Lehrveranstaltung ist und bei der die Ergebnisse
Challenge accepted: Seminarkonzept Problembasiertes Lernen online durchführen
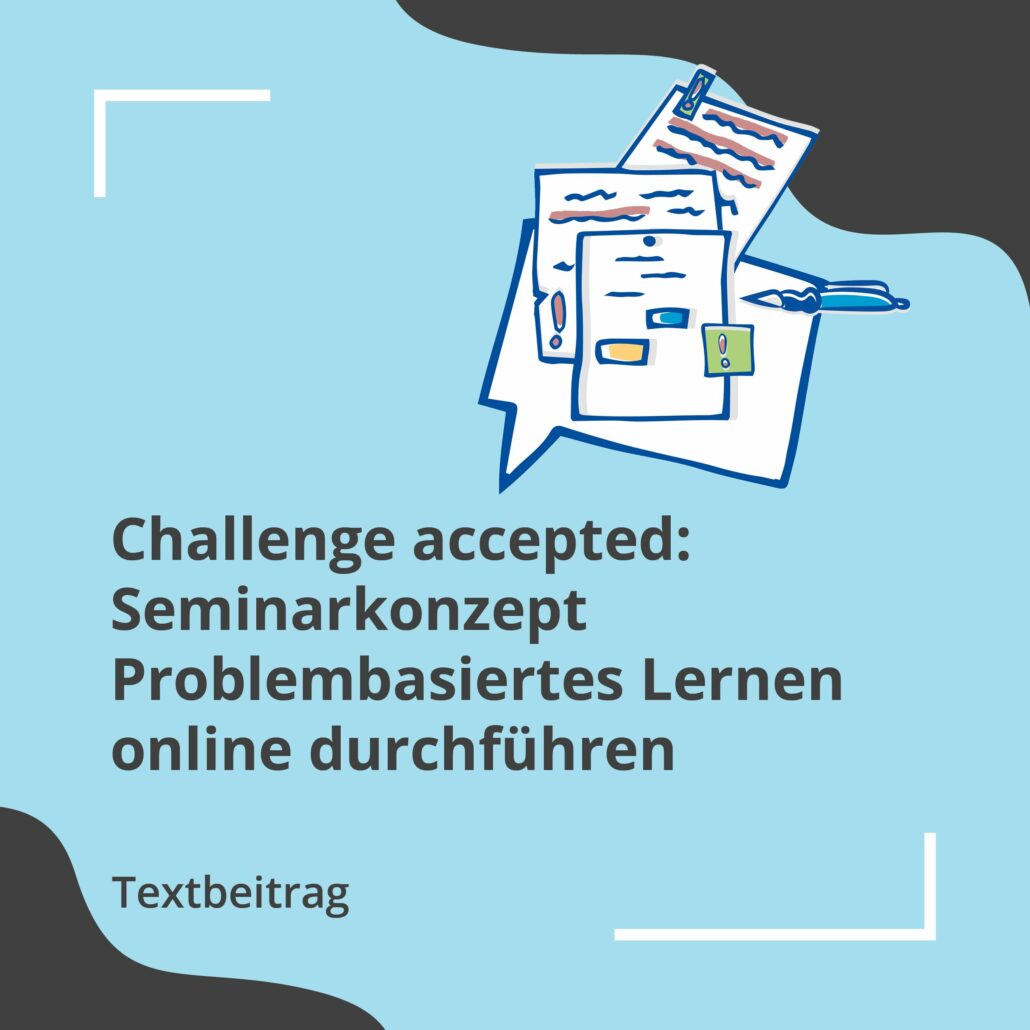
Challenge accepted: Seminarkonzept Problembasiertes Lernen online durchführen von Dr. Sophie Domann Als Lehrende im Bereich Sozial- und Organisationspädagogik an der Universität Hildesheim besuchte ich im Rahmen meiner hochschuldidaktischen Weiterbildung eine Veranstaltung zum Problembasierten Lernen. Aus dem sozialpädagogischen Bereich kannte ich bereits die Fallarbeit. Die Konzepte klangen sehr spannend und waren gleichzeitig mit viel Aufwand in der Vorbereitung und Durchführung verbunden. Da ich mich zum Zeitpunkt des Online-Kurses zum Problembasierten Lernen gerade in der Vorbereitung für meine Lehrveranstaltungen befand, beschloss ich mich in den Selbstlernphasen an einem entsprechenden Konzept für meine kommende Lehrveranstaltung zu versuchen. Challenge accepted!Die ersten Entwürfe für den Problemfall entstanden in einem Diskussions- und Anpassungsprozess zusammen mit den anderen Lehrenden und der Referentin des Weiterbildungskurses. Da ich aus vorherigen Semestern Erfahrungen in der Anleitung und Begleitung von Gruppenarbeiten gesammelt habe, konnte ich das Konzept gut integrieren. Die Idee wurde immer konkreter: in meinem Seminar wollte ich, dass die circa 25 Studierenden in Kleingruppen einen Problemfall zum Thema Jugendhilfe und Justiz bearbeiten. Die Ergebnisse sollten abschließend als E-Portfolio präsentiert und im Laufe des Semesters von individuellen Blogbeiträgen zur Erfahrung in der Gruppenarbeit flankiert werden. Auch Expertinnen lud ich zum Seminar ein, um einen Praxis-Einblick zu ermöglichen und Diskussionen anzuregen. PBL – WTF? Die Abkürzung PBL steht für Problembasiertes Lernen, das vernetztes Denken fördert und auf selbstbestimmtes und -reguliertes Lernen abzielt. Dabei werden Wissensinhalte in einen Kontext eingebunden. Insbesondere in den Niederladen und im medizinischen Bereich ist PBL schon längst eine etablierte Methode. Diese dient dort unter anderem der Grundlage der Neukonzeption von Studiengängen. In Deutschland findet PBL neben Medizin und Jura auch immer mehr in geisteswissenschaftlichen Studiengängen Anwendung. In den Kleingruppen herrscht intensive Interaktion. Die Gruppenmitglieder tragen die Selbstverantwortung für die Problembearbeitung. Es liegt meist eine hohe Praxisorientierung vor und die Methode kombiniert Inhalte mit Strategien der Aneignung und „aktiven Studieren“ statt frontaler Unterrichtsszenerie. Problembasiertes Lernen besteht aus acht Schritten: Abbildung 1: Selbsterstellte Grafik zur Zusammenfassung des Konzepts und der Informationen des Problembasierten Lernens. Erstellt mit Genehmigung von Canva. CC BY-SA 4.0. Kapitel PBL – WTF Warm-Ups und Techniken zum Kennenlernen Tools Gruppeneinteilung Fall für Studierende Reflexion und Rückmeldung – Challenge completed! Weiterführende Inhalte Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen Verbundarbeit im Fokus – Koordination, Qualitätssicherung und Zusammenarbeit im Projekt QUADIS Organisiert mit Infinity Maps in pädagogischen Seminaren Hochschulübergreifende Kooperation mit Transparenz und agilen Tools Kategorien How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Klärung von Verständnisfragen: Das Fallbeispiel wird von allen Anwesenden gelesen. Inhaltliche Unklarheiten (noch keine fachlichen!) werden in einer offenen Diskussionsrunde geklärt. Definition des Problems: Die Gruppe trägt zunächst die Teilprobleme des Fallbeispiels zusammen. Dabei sollten unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden. Die herausgearbeiteten Problemaspekte werden schriftlich festgehalten. Die Gruppe bestimmt die Problematik des Fallbeispiels näher. Erst nachdem Übereinstimmung erzielt worden ist, geht die Gruppe zum nächsten Bearbeitungsschritt über. Sammlung von Hypothesen und Ideen: Zu dem festgelegten Problem werden Vorkenntnisse, Vermutungen und Ideen durch die Gruppe gesammelt und für alle sichtbar z.B. auf Karteikarten, Tafel oder Flipchart geschrieben (Brainstorming). Zu diesem Zeitpunkt sollte noch keine Diskussion und kritische Bewertung der eingebrachten Kenntnisse und Ideen erfolgen. Ordnung von Hypothesen und Ideen: Die Gruppe ordnet nach selbst gewählten Prinzipien die vorgetragenen Inhalte und Ideen. Daraus wird ausgewählt, welche Aspekte für relevant und welche für entbehrlich gehalten werden. Formulierung der Lernziele: In diesem Schritt wird geklärt, welche Sachverhalte bereits bekannt sind und welche noch erarbeitet werden müssen. Zur systematischen Erweiterung des Vorwissens definiert die Gruppe genaue Lernziele. Diese werden ebenso schriftlich fixiert. Erarbeitung der Lerninhalte: Die formulierten Lernziele werden durch Nutzung von Bibliotheken und anderen Ressourcen (z.B. Internet, Expert*innen) erarbeitet. Dabei muss jedes Gruppenmitglied für sich und in Abstimmung mit den anderen entscheiden, wie die Lerninhalte im Einzelnen erarbeitet werden sollen. Synthese und Diskussion der Inhalte: Beim nächsten Treffen erfolgt die Präsentation des erarbeiteten Wissens, aufgrund dessen das Problem erneut in der Gruppe diskutiert wird. Nach Möglichkeit werden die wichtigsten Informationen schriftlich festgehalten und kritisch reflektiert. Dabei steht die Lösung des Problems nicht im Vordergrund. Oftmals sind verschiedene Lösungen möglich. Reflexion des Lern- und Gruppenprozesses: Jede PBL-Gruppensitzung sollte mit einer kurzen Evaluation abgeschlossen werden. Die Teilnehmenden können sich dazu äußern, wie sie die Lernprozesse und die Interaktion in der Gruppe einschätzen. Zum PBL gibt es noch bestimmte Anforderungen an die beteiligten Rollen. Die Moderation (Seminarleitung) übernimmt die Integration in das Curriculum sowie die Organisation und Evaluation der Lehrveranstaltung mit der Methode. Ich habe für die Veranstaltung die Einordnung in das Curriculum vorgenommen, Lehrziele formuliert, das Fallbeispiel konstruiert und bearbeitet, die Methode allen Beteiligten zugänglich gemacht, die Organisation und Evaluation der POL-Sitzungen übernommen und stand als Moderation der Gruppensitzungen und für mögliche Herausforderungen, Rückmeldungen etc. zur Verfügung. Im Plenum findet zu Beginn der Lehrveranstaltung ein gemeinsamer Einstieg in das Problem/Thema und die Methode statt sowie die Abschlusspräsentation der Ergebnisse am Ende. Die Kleingruppen aus Studierenden sind verantwortlich für ihre Abläufe, Prozesse und Ergebnisse. Dazu gehört den Ablauf der Methode als‚ Diskussionsleitung’ (die ‚Acht Schritte’) zu verantworten sowie auf gruppendynamische Prozesse einzugehen. Da die Seminarteilnehmer*innen aus unterschiedlichen Fächern/Studiengängen und Semestern kamen, habe ich von Beginn an vermittelt, dass ich gern die Gruppen zusammenstellen werde. Dabei achtete ich auf eine Mischung der Studiengänge und Fachsemester, um diverse Wissensstände und Kompetenzen zu versammeln. Vorab sorgte ich dafür, dass sich die Studierenden untereinander kennenlernten, ohne bereits zusammenarbeiten zu müssen. Dies ermöglichte ich mit verschiedenen Ice-Breakern und Warm-Ups in den einzelnen Sitzungen vor dem Beginn der Gruppenarbeiten. Warm-Ups und Techniken zum Kennenlernen Damit die Studierenden sich etwas kennenlernen und als Warm-Up der Sitzungen leitete ich verschiedene Ice-Breaker wie das Chatgewitter oder die Webentdeckungen an. Einen spannenden Austausch generierte ich auch durch den ABC Impuls. Dabei entstand eine Sammlung zu den bisherigen Assoziationen des Seminars zu Beginn des zweiten Drittels. Die Studierenden nutzten dabei die Reihenfolge des Alphabets. Abbildung 2: Selbsterstellte Grafik mit Beispielen von Warm-Up Aktivitäten wie „Chatgewitter Fragen“ und „Webentdeckung“. Erstellt mit Genehmigung von Canva. CC BY-SA 4.0. Abbildung 3: Selbsterstellte Grafik zur Zusammenfassung des ABC-Impuls. Erstellt mit Genehmigung von Canva. CC BY-SA 4.0.
Die linguistische Transkriptanalyse kollaborativ gestalten
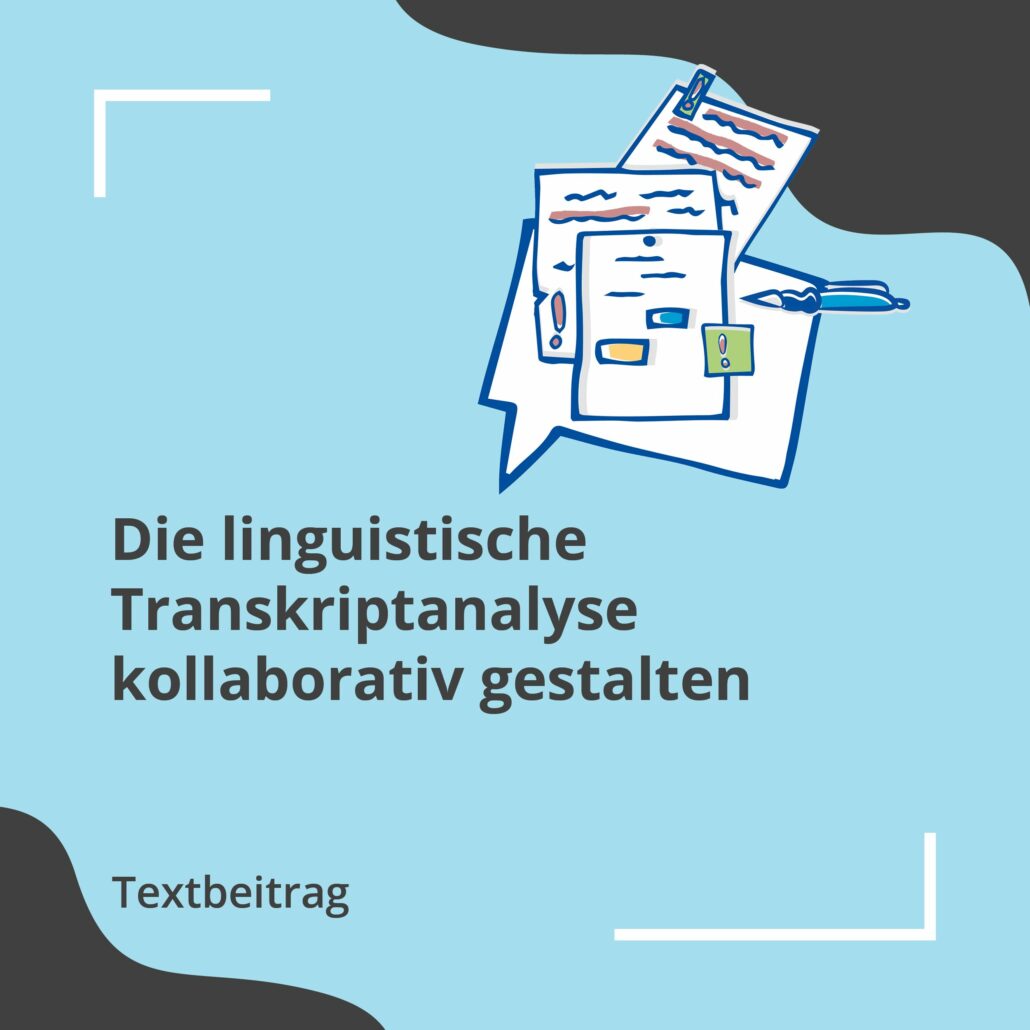
Die linguistische Transkriptanalyse kollaborativ gestalten von Anna Scarcella Insbesondere ab dem zweiten Semester des Studiums, nachdem erste fachliche Grundlagen bereits gelegt sind, beginnt für die Angewandte Linguistik und/oder Kommunikationswissenschaft die Arbeit am sprachlichen Material. Ob in mündlicher oder schriftlicher Form, Studierende sollen sich nun verstärkt mit den Besonderheiten von Sprache in ihrem jeweiligen Kommunikationszusammenhang beschäftigen. Da die gemeinschaftliche Bearbeitung von Aufgabenstellungen im Rahmen der Transkriptanalyse hohes Potenzial birgt (z.B. Einbezug der Perspektivvielfalt, gemeinsame Wissensgenerierung), habe ich selbst in meiner Lehre versucht, Arbeitsaufträge zu formulieren und Bedingungen für die Bearbeitung von Aufgaben zu schaffen, die kollaboratives Arbeiten ermöglichen. Dies schien insbesondere in Zeiten der digitalen Semester eine große Herausforderung zu sein, der mit entsprechenden digitalen Lösungen aber begegnet werden kann. Das Tool Collaboard ist – wie auch andere digitale Whiteboards – ein Beispiel für eine solche Lösung. Das Tool ermöglicht es Ihnen und Ihren Studierenden, zeitgleich und gemeinsam zu schreiben, zeichnen und externe Inhalte, wie bspw. Textmaterial oder Transkriptausschnitte einzufügen und mit Text oder farblichen Markierungen zu annotieren. Es funktioniert also ähnlich wie ein analoges Whiteboard oder eine Tafel, hat aber den Vorteil, dass alle Nutzer*innen von ihrem Endgerät darauf zugreifen und Inhalte parallel einfügen sowie einsehen können. In dem unten abgebildeten Beispiel ist ein in das Whiteboard hochgeladenes Transkript (Originalformat PDF) zu sehen, das am linken Rand zusätzlich mit Aufgabenstellungen für die Bearbeitung des Transkripts in einer Arbeitsgruppe von beispielsweise vier Personen versehen ist. Der inhaltliche Kern der Aufgabenstellung bezieht sich auf die Erarbeitungen von Funktionen eines sprachlichen Mittels (hier „but“) in seinem kommunikativen Zusammenhang und der getätigten Äußerung. Auf den vorgefertigten Karten unter der jeweiligen Frage bzw. Aufgabenstellung können Studierende einzelne Ergebnisse, die sie gemeinsam durch die Analyse des Transkripts erarbeiten, festhalten. Die Aufgabenstellung selbst enthält bereits Vorschläge, wie Markierungen im Transkript erfolgen können (Farbe und Form), um eine gute Nachvollziehbarkeit innerhalb der Arbeitsgruppe, aber auch im Nachgang für Studierende anderer Arbeitsgruppen zu gewährleisten. Abbildung 1: Selbsterstellter Screenshot der in Collaboard aufbereiteten Arbeitsfläche. Diese besteht aus den Aufgaben (links) und aus einem transkribierten Gespräch (rechts). Erstellt mit Genehmigung von Collaboard. CC BY-SA 4.0. Bevor die konkrete Analyse des Transkripts in Gruppenarbeit beginnt, besteht die Möglichkeit, ausführlicher über den Entstehungskontext des sprachlichen Ausgangsmaterials zu sprechen. Hierfür eignet sich besonders die Funktion, frei im Whiteboard Text zu verfassen und einzelne Textinhalte miteinander zu verknüpfen. So kann, wie unten abgebildet, eine durch Verbindungen visualisierte Form der handlungstheoretischen Auseinandersetzung mit der Kommunikationssituation als Ganzes erfolgen: Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen Verbundarbeit im Fokus – Koordination, Qualitätssicherung und Zusammenarbeit im Projekt QUADIS Organisiert mit Infinity Maps in pädagogischen Seminaren Hochschulübergreifende Kooperation mit Transparenz und agilen Tools Kategorien How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Abbildung 2: Selbsterstellter Screenshot weiterer Inhalte der Arbeitsfläche in Collaboard. Erstellt mit Genehmigung von Collaboard. CC BY-SA 4.0. Abbildung 3: Selbsterstellter Screenshot in Collaboard, der zeigt, wie eine Gruppe die Aufgabe gelöst und das Transkript annotiert hat. Erstellt mit Genehmigung von Collaboard. CC BY-SA 4.0. Abbildung 4: Selbsterstellter Screenshot der gelösten Aufgaben mit Platzhalter für mögliche Fragen. Erstellt mit Genehmigung von Collaboard. CC BY-SA 4.0. Im Anschluss an die nähere Betrachtung der Kommunikationssituation, in der die im Transkript festgehaltenen Äußerungen entstanden sind, kann die eigentliche Analyse des Transkriptes beginnen. Diese wird durch die nebenstehenden Fragen bzw. Aufgabestellungen (s.o.) geleitet. Der Vorteil an der Nutzung des Tools Collaboard oder anderer digitaler Whiteboards mit ähnlichen Funktionen ist, dass alle Studierenden der Arbeitsgruppe parallel mit farblichen Markierungen und Anmerkungen am Transkript arbeiten können. Gleichzeitig können Sie als Lehrperson den Fortschritt der Gruppenarbeit in Echt-Zeit beobachten und Studierende innerhalb des Kurses können das Vorgehen der anderen Arbeitsgruppen im Nachhinein durch Einsicht in die Analyse am Transkript nachvollziehen. Für die Vorstellung der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen im Plenum liegen dann für alle sichtbar die Ergebnisse auch in visueller Form vor, werden gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt erneut abgerufen werden. Dies erleichtert anderen Studierenden, der Ergebnispräsentation bzw. der Diskussion im Plenum zu folgen, da sie nicht zeitgleich mitschreiben müssen. Ergebnisse, die in dem Whiteboard gesammelt werden, können außerdem schnell und unkompliziert wieder bearbeitet und umsortiert werden, sollte eine Nachjustierung bzw. Korrektur einzelner Inhalte durch Sie als Lehrperson notwendig sein. Falls die Erkenntnisse zu einem späteren Zeitpunkt in Ihrem Seminar noch einmal relevant oder aber für weitere Analyseschritte verwendet werden sollten, so können Sie sie jederzeit wieder mit dem bereits vorliegenden Arbeitsstand abrufen und die Bearbeitung fortlaufend weiterführen. Zusätzlich zu den hochgeladenen Transkripten und leitenden Fragen bzw. Aufgabenstellungen für die Analyse kann in dem Whiteboard ein fester Platz vorstrukturiert werden, an dem Studierende Fragen, auf die sie während der Bearbeitung gestoßen sind, hinterlegen können. Dies hat den Vorteil, dass die Fragen für eine Nachbesprechung fixiert sind und nicht vergessen werden. Ggfs. können auch kurze Antworten auf andersfarbigen Karten als Lösungen oder Hilfestellungen formuliert werden. Das digitale Whiteboard kann für einzelne Aufgaben im Seminarkontext genutzt werden oder aber veranstaltungsbegleitend als nachhaltige Sammlung aller Erkenntnisse, die Sie mit Ihren Studierenden gemeinsam festhalten, dienen. So könnten Sie also auch einen zentralen Ort der Ergebnissicherung von Gruppenarbeiten oder Plenumsdiskursen schaffen. Das digitale Whiteboard ermöglicht es somit, den Wissenserwerb von Studierenden zu begleiten, die Zusammenarbeit unter Studierenden zu fördern und Sie als Lehrperson bei der Strukturierung und Aufbereitung von Inhalten zu unterstützen.
Diversitätssensibel Unterrichten dank Audience-Response-Tools

Diversitätssensibel Unterrichten dank Audience-Response-Tools von Julika Moos Ich war 26 Jahre alt, als ich zum ersten Mal als Dozentin vor einer Seminargruppe stand – 38 Studierende im Erstsemester, kaum jünger als ich. Ich war schrecklich verunsichert und gestaltete die Vermittlung so, wie ich dachte, wie Hochschullehre sein müsste. Erst Jahre später fiel mir auf, dass in meinen ersten Seminaren zwei Prinzipien dominierten: Angst – „wenn Sie das in der Klausur nicht können, fallen Sie durch“ – und ein falsches Verständnis von Fachkompetenz. Ich dachte, ich müsste auf jede Frage eine souveräne Antwort liefern können. Damit setzte ich sowohl meine Studierenden als auch mich selbst unter großen Druck. Der absurde Anspruch, alles wissen zu müssen, und keine Schwächen zuzugeben, war für uns alle gleichermaßen ungesund. Nach nun fast 10 Jahren in der Hochschullehre habe ich die Angst, etwas falsch zu machen, und das engstirnige Verständnis von Fachkompetenz, immer alles beantworten zu müssen, aus meinem Kopf verbannt. Stattdessen versuche ich meine Lehre nach zwei anderen Leitlinien zu organisieren: Begeisterung und Empathie. Zwar führt Angst – z. B. die davor, durch die Klausur zu fallen – durchaus dazu, dass Studierende den Stoff büffeln. Aber dass sie sich auch nach der Klausur noch an die gelernten Inhalte erinnern können, ist höchst unwahrscheinlich. Begeisterung für die Gegenstände des Fachs hingegen ist motivierend und ansteckend. Zwar lassen sich auch mit Begeisterung nicht alle Studierenden mitreißen, aber die Wissensvermittlung funktioniert meiner Erfahrung nach nachhaltiger und umfassender. Fachliche Begeisterung in der Lehre zu vermitteln, fällt den meisten Dozierenden, die ja aufgrund ihres Interesses am Fach an der Universität arbeiten, wahrscheinlich nicht schwer. Empathie aufzubringen, ist allerdings nicht immer ganz so einfach, weil sie z. B. auch beinhaltet, Verständnis dafür aufzubringen, dass Studierende für das eigene Leib- und Magenthema keine Begeisterung finden können. Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass Studierende auch fachlich aufgeschlossener sind, wenn sie sich menschlich gesehen fühlen. Wenn man ihnen mit Empathie vermittelt, dass sie mehr als nur eine beliebige Matrikelnummer sind, fühlen sich Studierende meiner Erfahrung nach sicherer. Ein Gefühl von Sicherheit im Seminarraum kann etwa dazu führen, dass sie sich an Seminardiskussionen beteiligen, auch wenn sie nicht ganz überzeugt sind, dass ihr Beitrag richtig ist. Ein Weg Studierenden mit Empathie zu begegnen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie gesehen werden, ist, sie in der ersten Sitzung zu fragen, wie sie angesprochen werden möchten. Die Ansprache mit Herr/Frau + Nachnamen – wie sie an deutschen Universitäten lange üblich war – stammt aus einer Zeit, in der wir von Vornamen und Aussehen auf das Geschlecht der Personen geschlossen haben. Mitunter fühlen sich Studierende aber nicht in der binären Geschlechterordnung abgebildet. Um auch für Studierende, die etwa nichtbinär oder trans sind, eine sichere Atmosphäre zu schaffen, sollte eine Ansprache mit Herr/Frau + Nachname heutzutage nicht mehr als ungefragter Standard gelten. Mit der zunehmenden Internationalisierung der Universitäten sind Rückschlüsse von Namen auf Geschlecht außerdem auch deshalb kaum noch zeitgemäß, weil Studierende nicht mehr nur gängige deutsche Vornamen haben. Vorannahmen über Namen aus nichtdeutschen Kulturkreisen können also im schlimmsten Fall rassistisch diskriminieren. Um schon in der ersten Sitzung des Semesters empathisch auf die Studierenden zuzugehen, ist es eine gute Idee, gleich zu Beginn nach ihrer gewünschten Ansprache zu fragen. Dies lässt sich mit einem Audience-Response-Tool, das anonyme Umfragen ermöglicht, sehr leicht umsetzen, sodass sich niemand vor der ganzen Seminargruppe offenbaren muss. In meinem letzten Seminar habe ich dazu das Umfragetool Vevox genutzt. In einer ersten Umfrage habe ich meine Studierenden über Vevox anonym gefragt, ob sie sich in einer binären Ansprache wiederfinden können. 14% der Teilnehmer*innen stimmten ab, dass diese Form der Ansprache für sie nicht funktioniert. Für diesen Fall hatte ich eine Anschluss-Umfrage vorbereitet, die andere Optionen der Ansprache im Seminar vorschlug und nach den entsprechenden Präferenzen der Studierenden fragte. Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen Vom Insta-Scroll zum Zoom-Call Virtuelle Zusammenarbeit verstetigt etablieren Kollaborative Lehrveranstaltungen gemeinsam umsetzen Kategorien How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Darin wollte ich wissen, ob die Studierenden eher geduzt oder gesiezt werden möchten. Dabei zeigte sich, dass niemand im Kurs darauf bestand, gesiezt zu werden, deshalb entschieden wir uns gemeinsam dafür, uns im Seminar mit Du + Vorname anzusprechen. Ich hoffe, ich konnte so dazu beitragen, dass sich alle in meinem Seminar wohlfühlten. Im Nachgang erhielt ich eine Email von einer Person aus dem Seminar, die mich in meinem Vorgehen bestärkte: „Danke für Deine Umfrage am Beginn der Veranstaltung, die zu einer für alle angenehmen Atmosphäre beigetragen hat.“ Tools, die anonyme Abstimmungen ermöglichen, können also nicht nur für reine Wissensabfragen genutzt werden können, sondern auch für sensible persönliche Nachfragen, die die Studierenden mit ihren individuellen Bedürfnissen ernst nimmt, ohne sie vor den Kommiliton*innen zu exponieren. Auch wenn das Duzen im Seminarkontext für mich zunächst ungewohnt war, weil ich das Sie lange als unabdingbar erachtete, um eine gewisse Distanz zu den Studierenden aufrechtzuerhalten, tat es der Stimmung im Seminar meiner Wahrnehmung nach wirklich gut: Ich brauchte mich nicht mehr als distanzierte Dozentin zu inszenieren, sondern konnte den Studierenden empathisch auf Augenhöhe begegnen und damit Interesse und Wertschätzung ausdrücken.
Seminarpläne neu denken (mit Canva!)
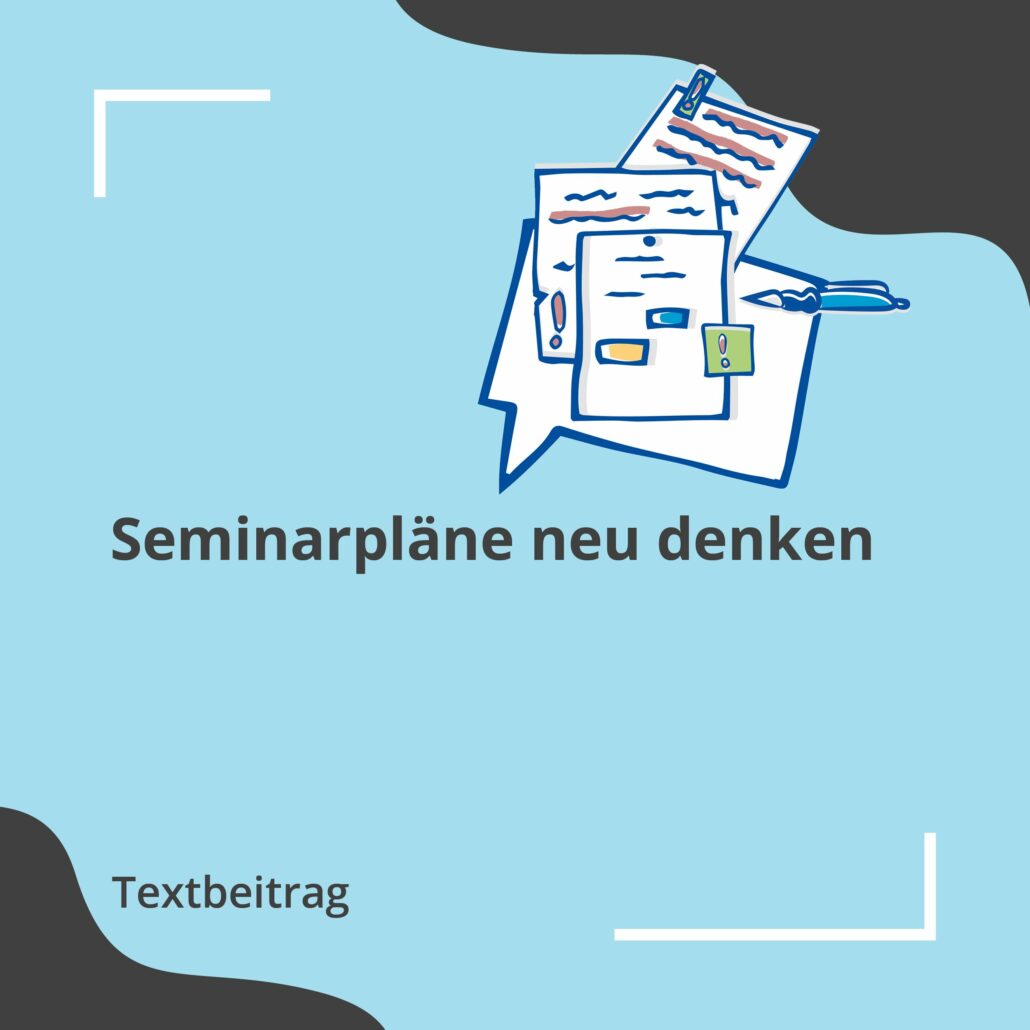
Seminarpläne neu denken (mit Canva!) von Julika Moos Ich habe an verschiedenen Universitäten in Deutschland und im Ausland verschiedene Fächer auf verschiedenen Sprachen studiert, aber eine Sache sah fast immer identisch aus: Von der Archäologie-Vorlesung bis zum Theologie-Hauptseminar waren Seminarpläne immer eine chronologische Abfolge von Daten, meist tabellarisch auf ein hochformatiges DIN-A4-Blatt gesetzt. Neben den chronologisch aufgeführten Daten fand sich darauf das Thema der jeweiligen Sitzung an einem bestimmten Datum, dazu manchmal noch die entsprechende Literatur zur Sitzung. Unter der tabellarischen Auflistung der einzelnen Termine gab es vielleicht noch ein paar Hinweise zum Lehrbuch oder zu Sprechstunden, aber das war es dann auch schon. Als ich selbst begann, Lehrinhalte zu gestalten, stellte ich die Form eines klassischen Seminarplans nie in Frage – dass ein Seminarplan eine Liste mit Daten beinhalten muss, war für mich einfach immer völlig klar. Also kopierte ich die Form der Seminarpläne, die ich aus meinem Studium kannte: DIN-A4-Word-Tabellen mit Daten. Und obwohl ich mir Mühe gab, mir ansprechende Titel für die einzelnen Sitzungen zu überlegen, behielt ich die altbekannte Form bei. Und ja, natürlich begann ich auch, Seminarpläne für Einführungsveranstaltungen, die ich mehrfach leitete, zu copy-pasten und vergaß dabei, die Jahreszahlen zu aktualisieren, sodass die Studierenden meiner Faulheit Effizienz gleich auf die Schliche kamen. Abbildung 1: Selbsterstellter Seminarplan für das Sommersemester 2019 im tabellarischen Format in einfacher Textformatierung. Erstellt mit Genehmigung von Canva. CC BY-SA 4.0. Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen 12# Wissensnugget – Winterpause 11# Wissensnugget – Chat AI als Lernbuddy Instagram als projektbegleitende Kommunikationsplattform für studentische Beteiligung Kategorien Aktuelle Veranstaltungen Allgemein How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Es dauerte Jahre, bis mir auffiel, dass es doch einigermaßen erstaunlich ist, dass die Form des typischen Seminarplans so beständig ist: Meine ersten Referate im Studium hielt ich noch mit Folien am Overhead-Projektor, mittlerweile unterrichte ich in hybriden Videokonferenzen mit interaktiven Präsentationen via Screenshare – aber Seminarpläne sehen immer noch genau gleich aus? Wie kann es sein, dass sich die Gestaltung der Lehre in den letzten Jahren so geändert hat, aber die Seminarpläne nicht? Eigentlich wissen Lehrende, dass Seminarpläne nach der ersten Sitzung schnell veralten: Mal fällt etwas aus, mal verschieben sich Sitzungsinhalte, die doch mehr Zeit beanspruchen, und irgendwie geraten die (ehrgeizigen) Pläne vom Anfang des Semesters dann schnell in Vergessenheit. Gerade wenn die Universität ein Lern-Management-System wie z. B. Stud.IP nutzt, werden Seminarpläne im laufenden Semester eigentlich kaum noch angeschaut: Im LMS gibt es ja einen Ablaufplan, der schneller wiederzufinden ist, als ein Zettel aus der ersten Sitzung. Und wenn dort dann gleich noch die Literatur zur jeweiligen Sitzung abgelegt ist, gibt es nun wirklich kaum einen Grund mehr, nochmal den Seminarplan herauszusuchen. Vielleicht sollten wir also Seminarpläne neu denken, denn als tatsächlichen Ablaufplan nutzen wir ihn, wenn wir ehrlich sind, doch eher selten. Trotzdem ist das Austeilen der Seminarpläne in der ersten Sitzung in einer Lehrveranstaltung ein wichtiges Ritual, das die Stimmung des Semesters beeinflussen kann: Genau genommen dienen Seminarpläne nämlich dazu, die Studierenden neugierig zu machen und ihnen eine Vorschau darauf zu geben, was sie im Lauf des Semesters erwartet. Aber statt Neugier zu wecken, tendieren wir oft dazu, Seminarpläne mit Informationen und Fachbegriffen – die die Studierenden ja noch gar nicht kennen können – zu überfrachten. Sollte die studentische Reaktion auf einen Seminarplan aber nicht eher „oh, das klingt aber vielversprechend“ oder „auf diese Inhalte freue ich mich“ lauten statt „uff, das liest sich aber anstrengend“? Was also, wenn wir Seminarpläne mehr wie einen Filmtrailer verstehen? Als einen Teaser für die kommenden Wochen, ohne konkret vorgegebene Inhalte und stattdessen mit einem Fokus auf die Highlights, die die Studierenden erwarten? Dann können wir uns von der langweiligen tabellarischen Form lösen und anfangen, schon in der ersten Sitzung den Schwerpunkt darauf zu lenken, was die Studierenden im kommenden Semester begeistern und mitreißen könnte! Eine Möglichkeit, einen Seminarplan kreativer und anregender zu gestalten, ist die Nutzung des Design-Tools Canva. Damit können auch mediengestalterische Laien ansprechende Designs erstellen, die nicht mehr nach einer Word-Tabelle aussehen, sondern eher wie ein Flyer für ein Event. Es lassen sich damit sehr unkompliziert Fotos, Grafiken oder QR-Codes zu Videos einbauen, die das Interesse der Studierenden vielleicht viel eher ansprechen, als Daten und Listen mit Fachbegriffen und Fachliteratur. Natürlich kommt ein Seminarplan nicht ganz ohne organisatorische Hinweise aus, aber gerade wenn ohnehin ein begleitendes Lern-Management-System genutzt wird, braucht es diese vielleicht gar nicht, weil sich die wichtigen Infos online finden lassen. Stattdessen kann sich die Gestaltung des Seminarplans dann ganz darauf fokussieren, was dessen wichtigste Aufgabe in der ersten Sitzung ist: Vorfreude zu wecken! Abbildung 2: Selbsterstellter Seminarplan für das Wintersemester 2022/2023. Erstellt mit Genehmigung von Canva. CC BY-SA 4.0.
Das ganze Seminar auf einen Blick: Wie ein Whiteboard-Tool die literaturwissenschaftliche Lehre bereichern kann
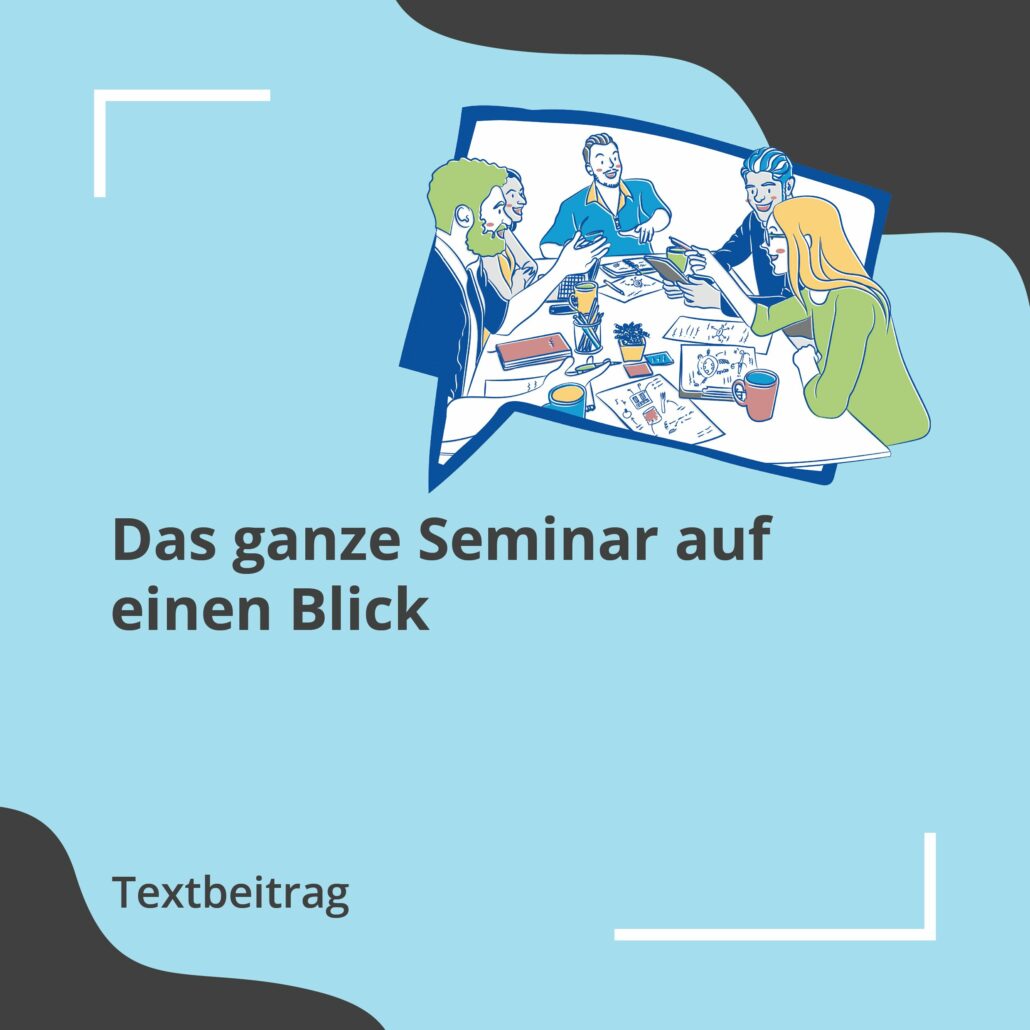
Das ganze Seminar auf einen Blick: von Julika Moos Wie ein Whiteboard-Tool die literaturwissenschaftliche Lehre bereichern kann Im letzten Semester wagte ich ein Experiment: Ich bot ein Vertiefungsseminar in der germanistischen Mediävistik an, in dem ein über 21.000 Verse umfassender mittelhochdeutscher Roman gelesen und besprochen werden sollte. Das ist für ein Mediävistik-Seminar zunächst nicht ungewöhnlich – vor allem im höheren Semester können wir den Studierenden durchaus größere Textmengen zumuten. Die spezifische Herausforderung war allerdings, dass der Roman nicht – wie viele der anderen Texte, mit denen wir in der Lehre hauptsächlich arbeiten – in einer neuhochdeutschen Übersetzung vorliegt. Obwohl der Text unter Forschenden bekannt ist, bleibt er für Studierende recht unzugänglich und wird in der Lehre kaum behandelt. Tatsächlich gibt es zu Konrads von Würzburg Roman nicht mal einen Wikipedia-Artikel! Mir war also sehr bewusst, dass ich die Studierenden nicht nur mit einem umfassenden Primärtext herausfordere, sondern auch mit einer schwierigen Lektüre konfrontiere, die sie vermutlich öfter mal an ihre Grenzen bringen würde: Gereimte Verse, eine ältere Sprachstufe und unbekannte Ausdrücke sorgen oft schon für Verwirrung, selbst wenn eine neuhochdeutsche Übersetzung zur Verfügung steht. Ich brauchte also unbedingt einen Weg, um Lektüre, Besprechung und Analyse dieses mittelhochdeutschen Romans für die Studierenden zugänglicher zu machen. Dazu benutzte ich das Kreativtool Miro. Das Hauptfeature dieses Tools ist ein digitales Whiteboard, auf dem sich zahlreiche unterschiedliche Gestaltungsformen anbringen lassen. In der ersten Seminarsitzung stellte ich Miro als ein gemeinsames Seminarprojekt vor, das wir im Lauf des Semesters gemeinsam befüllen würden. Weil das Tool (bisher) nicht DSGVO-konform ist, holte ich das Einverständnis der Studierenden ein, dieses Tool dennoch gemeinsam zu nutzen. Die Nutzer*innen des gemeinsamen Whiteboards meldeten sich mit einer Email-Adresse an; ohne Anmeldung und spezifischen Einladungslink kann das Board nicht eingesehen oder verändert werden. Ich widmete jedem im Seminar gelesenen Textabschnitt eine dezidierte Sektion in unserem Whiteboard. In jeder dieser Sektionen zu einem Textabschnitt brachte ich ein großes Feld an, in das visuelle Assoziationen zur gelesenen Textpassage eingefügt und die Studierenden so aktiv zur kreativen Mitarbeit angeregt werden sollten. Ich gab den Studierenden dazu – wie in literaturwissenschaftlichen Seminaren üblich – einen jeweils konkreten zu lesenden Textabschnitt vor und bat sie, als Teil ihrer Vorbereitung für die Sitzung, in der dieser Romanauszug behandelt werden sollte, passende Fotos herauszusuchen, die diese Szene bildlich beschreiben könnten, um diese dann im Board zu teilen. Kapitel Vorstellung des Kreativtool Miro Visuelle Annäherung Felder für Rückmeldungen Interaktive Tafel Anonyme Evaluation Fazit Neueste Beiträge All Posts How to Uni How to Tool How to Co-Work Aktuelle Veranstaltungen Verbundarbeit im Fokus – Koordination, Qualitätssicherung und Zusammenarbeit im Projekt QUADIS Organisiert mit Infinity Maps in pädagogischen Seminaren Hochschulübergreifende Kooperation mit Transparenz und agilen Tools Kategorien How to Co-Work How to Tool How to Uni Vergangene Veranstaltungen Diese visuelle Annäherung an den Romaninhalt brachte in vielerlei Hinsicht Vorteile mit sich: Für die Studierenden wurde so deutlich, dass sie bei ihrer Lektüre nicht jedes Wort verstehen mussten, sondern dass es ausreichte, z.B. ein Bild von einem Schiff im Mondschein herauszusuchen, wenn sie diesen Aspekt der verstanden und als bedeutend erkannt hatten. Das Bildersuchen hatte damit gleichzeitig etwas Spielerisches, das die Angst vor diesem umfangreichen und sicher teilweise unverständlichen Text deutlich reduzierte. Sobald die ersten Seminarteilnehmer*innen ihre Bilder eingefügt hatten, funktionierten diese wiederum als Absicherung für diejenigen, die erst etwas später mit der Lektüre beginnen konnten: Die Bilder der anderen sorgten, so mein Eindruck, für Rückversicherung dessen, was verstanden wurde und trugen so zu einem selbstbewussten Umgang mit dem Text bei. Die Bilder-Collage in unserem gemeinsamen digitalen Whiteboard half gleichzeitig dabei, dass ich in meiner eigenen Vorbereitung auf die einzelnen Seminarsitzungen sehr viel besser antizipieren konnte, wie viel die Studierenden von der zu lesenden Textpassage verstanden hatten und wie viel Zeit wir brauchen würden, um über die Passsage zu sprechen. Es bereitete mir selbst richtig Freunde, im Lauf der Woche immer mal wieder ins Board zu schauen, ob unsere gemeinsame Collage mittlerweile wieder gewachsen war und festzustellen, dass die Studierenden doch deutlich mehr verstanden, als ich anfangs zu erwarten gehofft hatte. Am Ende des Semesters fügten sich die einzelnen Bilder-Collagen zu einer visuellen Timeline des Romans zusammen: Weil ich Freifelder für die Bilder-Sammlungen in der Planung des Boards nebeneinander angebracht habe, stellen sie nun eine Art visuellen Zeitstrahl dar, mit dem sich die Handlung des Romans visuell rekapitulieren lässt. Gerade für jene Studierenden, die jetzt eine Hausarbeit schreiben, dürfte der Mehrwert dieser visuellen Inhaltszusammenfassung äußert hilfreich sein, wenn sie eine bestimmte Textstelle suchen, sie aber in den tausenden von Versen nicht auf Anhieb finden können. Die Orientierung im Text anhand der gemeinschaftlich erstellten Bilder-Collagen dürfte den Studierenden deutlich leichter fallen. Zusätzlich zu der jeweiligen Bilder-Collage richtete ich für jede Sitzung spezifische Felder für Rückmeldungen ein, in denen digitale Notizzettel angepinnt werden konnten: Es gab eine Ecke für allgemeine Beobachtungen zum Textabschnitt, in denen wir etwa besonders wichtige Zitate, den Auftritt neuer Figuren oder kurze Paraphrasen essenzieller Teilabschnitte der Handlung sammelten. Eine weitere Ecke war Problemen und Ungereimtheiten im Text gewidmet: Hier konnten schwer verständliche Worte oder Textphrasen gesammelt werden, die ich oft auch vor der Sitzung im Board beantwortete. Ein weiteres Feld war als Ideenspeicher für Themenwünsche gedacht: Wenn den Studierenden etwas aufgefallen war, über das sie gerne sprechen wollten, konnten sie diese Ideen dort sammeln, sodass wir sie dort nicht aus dem Auge verlieren würden. Nach der ersten Sitzung bemerkte ich, dass man die Annäherungen an den Inhalt auch noch weiter visualisieren könnte und richtete für jede Sitzung außerdem eine zusätzliche Meme-Corner ein, in der lustige Adaptionen der Romanhandlung geteilt werden konnten. Um die Studierenden zur aktiven gemeinsamen Beiteilung an unserer digitalen Tafel zu ermuntern, verzichtete ich darauf, alternatives Material wie Präsentationen zu benutzen, weil diese eine eher passive Rezeption nach sich zögen. Stattdessen ermunterte ich die Studierenden, auch in den Seminarsitzung mal ein Bild in das Board einzutragen: Eine Studentin verglich etwa die handlungslenkende Darstellung einer Figur mit dem Film „Die Truman Show“, sodass wir – weil der Vergleich so passend war – in der Seminardiskussion live ein Bild des Filmplakats in unsere Collage einfügten, um

